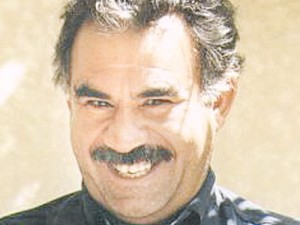Entgegen der herrschenden Mode versucht der vorwärts mit dem Schwerpunkt «Klassen und Klassenkämpfe» daran zu erinnern, dass der Widerspruch zwischen ArbeiterInnen und Kapital für eine revolutionäre Perspektive nach wie vor zentral ist. Der vorliegende Text will einige Banalitäten zu diesem Themenfeld aktualisieren, die vor Jahrzehnten durch moderne und postmoderne Ideologien verschüttet wurden.
Entgegen der herrschenden Mode versucht der vorwärts mit dem Schwerpunkt «Klassen und Klassenkämpfe» daran zu erinnern, dass der Widerspruch zwischen ArbeiterInnen und Kapital für eine revolutionäre Perspektive nach wie vor zentral ist. Der vorliegende Text will einige Banalitäten zu diesem Themenfeld aktualisieren, die vor Jahrzehnten durch moderne und postmoderne Ideologien verschüttet wurden.
Aus der Printausgabe vom 26. April. Unterstütze uns mit einem Abo.
Es ist längst nicht mehr en vogue, sich auf die alten Begriffe von Klasse und Klassenkampf zu berufen. SoziologInnen und andere staatlich finanzierte IdeologInnen haben den grossen Abschied vom Proletariat längst vollzogen. Aber auch grosse Teile der Linken haben sich abgewandt und mit grossem Eifer auf allerhand Ersatzobjekte gestürzt. Von den BerufsdenkerInnen soll im Weiteren keine Rede mehr sein. Ihre aufwendige Kategorisierung der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft mag man spannend finden oder gar zur Profession machen, für revolutionäre Absichten sind zumindest ihre aktuellen Varianten von untergeordneter Bedeutung.
Der Abschied vom Proletariat
Ein guter Teil der Linken machte sich nebst Oberflächenbeschreibungen kaum die Mühe zu begründen, warum man nun die Klasse als alten Hut ansah, und stürzte sich recht blindlings auf allerhand neue Objekte der Begierde. In jenen Kreisen spricht man heute lieber vom Prekariat, von der Multitude oder man imaginiert sich in eine Front mit irgendwelchen kämpfenden Völkern. Ab und zu sind diese Lieblingsobjekte nach Geschmackskriterien gewählt, wie etwa die liebste Musikrichtung. Doch in welchem Zusammenhang stehen diese mehr oder weniger modernen Subjekte mit der Überwindung des Kapitalismus? Auch jene, die es ein wenig ernster meinen, können diese Frage kaum und nur schlecht beantworten. Nimmt man Abstand von der Klasse (oder ersetzt sie durch bestimmte Fragmente derselben oder durch einen kruden Volksbegriff), bleibt für immer im Dunkeln, wie man die Totalität durch die Aneignung und Veränderung der Produktionsmittel sowie der gesamten Art und Weise der gesellschaftlichen Reproduktion aufheben will.
Der marxistisch verbrämte Abschied von der Klasse führte über ihre nahtlose theoretische Integration ins Kapitalverhältnis. Da verordnete man den Widerspruch zwischen Kapital und ArbeiterInnen als dem Kapitalverhältnis gänzlich immanent und dachte damit die Proletarisierten bloss noch als Anhängsel des Kapitals. Eine andere Variante desselben Irrsinns erklärte, dass mit der reellen Subsumtion – also mit der Unterordnung des Arbeitsprozesses unter das Kapital – jegliche revolutionäre Sprengkraft verloren gegangen sei. In aller Kürze: Beiden Varianten ist eigen, dass sie Arbeit und Arbeitskraft in eines setzen. Die Arbeit als der Prozess, in welchem die Proletarisierten am Arbeitsplatz beschäftigt sind, wird heute tatsächlich komplett vom Kapital bestimmt und ist nicht mehr, wie etwa die Tätigkeit der HandwerkerInnen im Frühkapitalismus, bloss formell subsumiert. Die Arbeitskraft jedoch liegt immer in Gestalt eines Menschen mit all seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen vor, die eben der Vernutzung durch das Kapital widersprechen können.
Histomat und Arbeiterbewegung
Es waren häufig dieselben Linken, die vor dem Abschied vom Proletariat dessen glühendste VerfechterInnen waren. Da geisterte der historische Materialismus als Verbürgung der Zwangsläufigkeit der proletarischen Revolution durch allerhand eigentlich recht helle Köpfe. Man stellte sich vor, dass die objektiven Entwicklungsgesetze zur Revolution drängten. Es musste bloss noch die Kommunistische Partei zwischen die Klasse und ihre Befreiung treten. Auch die linken KritikerInnen dieser Vorstellung waren meist nicht wesentlich weiter. Ihre Perspektive unterschied sich vor allem darin, dass die Befreiung der Arbeiterklasse das Werk nur dieser Klasse sein könne und mit historischer Notwendigkeit auch sein werde. Diesen fixen Ideen machten die faschistische und die stalinistische Konterrevolution einen Strich durch die Rechnung. Dies führte dazu, dass eine ganze Generation kritischer MarxistInnen den Weltenlauf nicht mehr auf die Revolution gerichtet verstanden, sondern hauptsächlich als eine Dialektik von Anpassung und Konterrevolution. Die Abkehr vom Proletariat war in vielen Fällen die Abkehr von metaphysischen Gewissheiten, bei der allerdings auch ein wahrer Kern verloren ging. Die proletarische Sache hatte in ihren eifrigsten VertreterInnen häufig sehr schlecht FürsprecherInnen.
Dazu kam, dass sich die traditionelle Arbeiterbewegung – die von vielen fälschlich mit der kämpfenden Klasse gleichgesetzt wurde – zusehends in die bürgerliche Gesellschaft auflöste. Die «Gesellschaft in der Gesellschaft», die sich auch ausserhalb von Kampfphasen in diversen ArbeiterInnenvereinen und -organisationen kristallisierte, verlor zusehends an Kraft. Die politische Anerkennung, die sozialstaatliche Integration und die sich in oftmals abgetrotzten Lohnerhöhungen manifestierenden Produktivkraftzuwächse leisteten ganze Arbeit. Den alten Zeiten und Strukturen trauern heute noch verschiedene proletarische Gesangsvereine und Folkloretruppen nach und kopieren mit wenig Erfolg all deren Fehler. Es folgte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit der relativen Stabilität, in der die Proletarisierten nebst lebenslangen Arbeits- und Ausbeutungsverhältnissen auch auf Waschmaschine und Kleinwagen zählen durften. Die aktuelle aber latent schon seit den 70ern schwelende Krise und die dazugehörigen materiellen Angriffe auf die Proletarisierten kündigten und kündigen diesen Zustand mit ziemlicher Wucht auf. Darin liegt, bei aller Härte für die Betroffenen, ein Potential – nicht aber eine Notwendigkeit –, das weit über die alte ArbeiterInnenbewegung mit ihrer Identifikation mit der Arbeit und ihren ProtagonistInnen hinausweist und stattdessen die Möglichkeit nach deren Aufhebung in einer klassenlosen Gesellschaft auf die Tagesordnung setzen könnte.
Die Klasse an sich…
Einige besonders kritische KritikerInnen meinen, man habe den Begriff der Klasse ad absurdum geführt, wenn man auf den unscharfen Rändern der Klassen beharrt. Es darf nicht erstaunen, dass in Zeiten von Kleinaktionärin, Manager und arbeitsloser Akademikerin die Begriffe flöten gehen und man sich stattdessen in der bunten Oberfläche der Gesellschaft verliert. Dabei ist es eigentlich relativ einfach: Zur Arbeiterklasse gehören erst mal alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen oder müssten, um in dieser Gesellschaft zu leben. Dazu zählen auch jene, die indirekt vom Lohn oder von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. Man kann natürlich weiter differenzieren und etwa die Verfügungsgewalt über Kapital oder die bestimmte Stellung zur aktiven Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft zum Thema machen. Obwohl die Klasse auf der Seite des Kapitals zusehends abstrakt und auf der Seite der Proletarisierten diffus wird, verlieren die Unklarheiten relativ schnell an Gewichtung, wenn man die Sache zu Ende denkt: Der Kleinaktionär etwa muss trotz seinen paar UBS-Aktien weiterhin Lohnarbeit verrichten, während der hohe Manager nach einigen Jahren gut von seinem erworbenen Kapital wird leben können. Ebenso flach sind die Einwände, dass die MalocherInnen in ihrer grossen Masse heute nicht mehr im Blaumann an der Stanze stehen. Das ist verkehrt, weil die Klasse als globaler Zusammenhang in grossen Teilen immer noch Industriearbeit verrichtet. Auch bleibt ein ultra-flexibilisierter Dienstleistungsangestellter nach wie vor von seinem Lohn abhängig und leistet sogar – entgegen linker Legendenbildung – unter bestimmten Umständen produktive Arbeit. In der ökonomischen Bestimmung der Klasse wird man sich mit den vernünftigeren Zeitgenossen nach einiger Diskussion dann meist auch einig.
Dennoch ist es nicht ganz so einfach. Die Klasse ist keine homogene Masse, sie ist weitestgehend fragmentiert: In ihrer globalen Zusammensetzung gibt es etwa zwischen der Peripherie und den Metropolen massive Unterschiede und es steht auf der Tagesordnung, dass billige Arbeitskräfte aus dem Trikont gegen die Stammbelegschaften in Europa ausgespielt werden. Wer allerdings den Begriff der Klasse ernst nimmt, muss diese als globale Grösse denken. Nur so kann man auch der Falle entgehen, sich in isolationistische und nationalistische Irrwege zu verirren, wie das einigen, vermeintlich kommunistischen, Gruppen im Zuge der Diskussion um die Personenfreizügigkeit passiert ist. Nebst dieser internationalen Fragmentierung ist die Klasse auch entlang von rassistischen oder sexistischen Spaltungslinien geteilt, in ArbeiterIn und Arbeitslose gespalten und in unterschiedlichste Interessensgruppen zersplittert (von denen die berühmte Mittelschicht nur eine der bekanntesten und wirkungsmächtigsten ist). Auch darum ist der Übergang von der Klasse als objektiver Bestimmung zur Klasse als kämpfendem Subjekt so unendlich schwierig. Hier soll der Hinweis genügen, dass in kollektiven Kämpfen zumindest das Potential entsteht, dass man gemeinsam vorherrschende Spaltungen überwindet und aus atomisierten Lohnabhängigen und Arbeitslosen gesellschaftliche Wesen werden, die beginnen, ihr Leben gemeinsam neu zu organisieren.
...und der legendäre Übergang
Die subjektive Seite des Klassenbegriffs ist in den vergangen Jahrzehnten zusehends verschüttet worden. Tatsächlich lässt sich diese Konstitution der Klasse als handelndes Kollektiv nicht mit derselben Genauigkeit aus den ökonomischen Verhältnissen ableiten wie ihre objektive Bestimmung. Man muss sich deshalb aber nicht dumm machen lassen wie einige akademische MarxistInnen, die aus diesem Notstand – dass sich der sprengende Klassenkampf nicht mit derselben Stringenz wie die Wertformanalyse begründen lässt – gleich ihre Kapitulation folgen liessen. Trotzdem: Selbst die Operaisten aus Italien haben mit ihrer Suche nach dem zentralen widerständischen Subjekt und ihrer peniblen Bestimmung der technischen und der politischen Klassenzusammensetzung nach interessanten Anfängen nicht wesentlich mehr erreicht, als die Überstilisierung eines bestimmten (bei Antonio Negri dann nur noch diffusen) Typus‘ des Arbeiters – auch wenn sie das nicht aus dem «Kapital», sondern aus den reellen Arbeitsbedingungen der Klasse ableiteten. Man sollte sich davor hüten, mit zu grosser Sicherheit den Umschlagpunkt zu prognostizieren und ihn aus bestimmten Bedingungen ableiten zu wollen. Allerdings ist es nur vernünftig, die Beweislast umzukehren: Man muss nicht beweisen, dass die Proletarisierten dereinst die Revolution machen. Das wäre im Resultat ein metaphysisches Unterfangen und würde dem alten Histomat alle Ehre machen. Wenn man es aber mit der kommunistischen Revolution ernst meint, dann sollte man sich klar darüber sein, warum man auf die proletarische Insubordination verwiesen ist. Sonst bleibt, und das kann man an den verschiedenen sonderbaren Ausformungen der Linken erkennen, in der Regel nicht viel mehr übrig, als blanker Dezisionismus, hoffnungsloser Aufklärungsidealismus oder krude Zusammenbruchfantasien.
Auch wenn man historisch argumentiert und auf wiederkehrende Kampfwellen der Proletarisierten verweist, kann man nie mit Bestimmtheit sagen, was neben den konkreten Konfliktsituationen die untergründigen Auslöser für die Aufstände waren. Der heisse Mai 1968 in Paris und der lange Mai in Italien haben aber gezeigt, dass Teile der Klasse sehr wohl auch ausserhalb oder sogar gegen die traditionellen Organe der Arbeiterbewegung kämpfen können, und dass sich die Klasse als Subjekt unter widrigsten Umständen konstituieren kann.
Warum die ArbeiterInnen?
Proletarisiert sind heute weltweit so viele Menschen wie noch nie zuvor: Die Menge an Arbeitsplätzen hat weltweit absolut zugenommen. Gleichzeitig wächst die schiere Masse an lebenslänglich Überflüssigen an der Peripherie, aber zunehmend auch in den krisengeschüttelten Metropolen. Die Fähigkeit des Kapitals, die ArbeiterInnenmassen in den Produktionsprozess zu integrieren, wird heute zusehends in Frage gestellt. Damit drängt sich bei vielen Menschen die recht banale Frage auf, wie sie ihr Leben ausserhalb der Reproduktionskreisläufe des Kapitals organisieren können. Die schlichte Masse der von diesem Prozess Betroffenen, wie etwa die Masse der zusehends prekären BesitzerInnen der Arbeitsplätze, macht es gewissermassen unumgänglich, dass sie sich der Revolution anschliessen, soll sie nicht wieder in Bevormundung und Stellvertretertum enden. Oder wie ein bärtiger Mann in einem recht berühmten Agitationsbüchlein geschrieben hat: «Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl.» Die Aneignung der Produktionsmittel und ihre Umwandlung in Mittel der Produktion für eine vernünftige und klassenlose Gesellschaft ist ohne jene, die heute diese Maschinerie bedienen, ohnehin undenkbar – auch wenn die Maschinerie für eine vernünftige Gesellschaft in grossen Teilen erst mal geändert werden müsste.
Die ArbeiterInnen, und das ist entscheidend, sind jene Menschen, die das Kapital produzieren und reproduzieren. Nicht nur haben sie als die ProduzentInnen des gesellschaftlichen Reichtums eine grosse Macht gegenüber dem Kapital, sie sind es, die es tagtäglich überhaupt (re)produzieren und die darum auch damit aufhören können – auch wenn ihnen das Kapital als fremde Macht gegenübertritt; als tote Arbeit, die davon lebt, lebendige Arbeit einzusaugen. Ohne die Ausbeutung der ArbeiterInnen kann das Kapital nicht existieren. Es ist schlicht nicht denkbar ohne seinen gesellschaftlichen Gegenpol. Darum sagt der Begriff der Klasse weit mehr über die innere Funktionsweise des Kapitalismus aus, als jede noch so differenzierte Ausmalung der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten. Die ArbeiterInnen sind als variables Kapital selber Bestandteil des Kapitalverhältnisses, aber sie treten immer in ihrer ganzen Subjektivität in den Arbeits- und Verwertungsprozess ein. Es ist etwa mit dem Verkauf der Arbeitskraft noch längst nicht Intensität und Länge der Ausbeutung bestimmt. Diese Spannung schlug – nebst der täglichen kleinen Verweigerung – in der Geschichte immer wieder in handfeste gesellschaftliche Auseinandersetzungen um. Nicht umsonst ist dem Kampf um die Länge des Arbeitstages im ersten Band des «Kapitals» ein ganzes Kapitel gewidmet. Gerade in der Krise wird deutlich, dass das Kapital immer wieder auf die Ausdehnung des absoluten Mehrwerts angewiesen ist.
Grenzen des Kapitals
Diese furchtbar abstrakten Bestimmungen sind keine bloss theoretische Spielerei. Die Begriffe, mit denen wir die Welt erfassen, haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir gesellschaftliche Veränderungen und Kämpfe wahrnehmen. Es wäre also wichtig, die jüngeren Proteste unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes zu analysieren. Auch in ihrer politischen Beschränktheit weisen einige Kämpfe im arabischen Raum oder in den krisengeschüttelten Euro-Staaten ein Potential auf, das über ihren engen politischen Horizont hinausweist. Aber auch die Aufstände der für das Kapital häufig schlicht überflüssigen untersten Segmente der Proletarisierten in den Banlieus in Frankreich oder in London, müssen mit demselben Instrumentarium analysiert werden. Da formiert sich möglicherweise etwas, was von proletarisierten Massen getragen wird und sich objektiv gegen Angriffe auf ihr Lebensniveau richtet – deren Gelingen aber auch davon abhängt, wie man die Inter-essen der ungeheuren Masse an überflüssigen Proletarisierten einbeziehen kann. In der Aufkündigung des alten Konsenses von oben zeichnet sich auch langsam – momentan wieder etwas verstockt – eine Aufkündigung von unten ab. Denn vielen Menschen scheint mittlerweile zu dämmern, dass die Krise für grosse Teile kaum mehr einen Spielraum lässt zwischen dem vollumfänglichen Akzeptieren von Austritätsmassnahmen und der radikalen Umwälzung ihres ganzen Lebens. Wenn man sich diesen Widerspruch vergegenwärtigt, die potentiellen Lernprozesse in den Kämpfen beobachtet und sich nicht wieder in den Führerstand des zum Weltgeist aufgeblasenen Proletariats imaginiert, dann besteht zumindest die Chance, dass KommunistInnen dieses Mal schlaueres zu den kommenden Klassenkämpfen zu sagen und beizutragen haben.
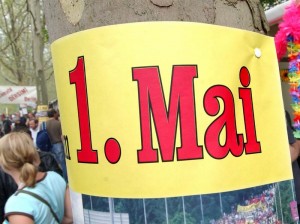 Zürich. Besammlung in der Lagerstrasse um 9.30 Uhr, Schlusskundgebung auf dem Bürkliplatz. Anschliessend mehrtägiges Fest auf dem Kasernenareal. Als RednerInnen geladen sind Sofia Roditi (Sprecherin des Frauenkomitees im Stahlwerk von Aspropyrgos, Griechenland), Marina Carobbia (SP-Nationalrätin und Präsidentin MieterInnen-Verband Schweiz) sowie Susi Stühlinger (Journalistin bei der WOZ und Schaffhauser AL-Kantonsrätin)
Zürich. Besammlung in der Lagerstrasse um 9.30 Uhr, Schlusskundgebung auf dem Bürkliplatz. Anschliessend mehrtägiges Fest auf dem Kasernenareal. Als RednerInnen geladen sind Sofia Roditi (Sprecherin des Frauenkomitees im Stahlwerk von Aspropyrgos, Griechenland), Marina Carobbia (SP-Nationalrätin und Präsidentin MieterInnen-Verband Schweiz) sowie Susi Stühlinger (Journalistin bei der WOZ und Schaffhauser AL-Kantonsrätin)