 Der Streik im Krankenhaus «La Providence» in Neuchâtel hat den 60. Tag überschritten. Die Streikenden geben nicht auf und führen die Mobilisierung trotz grosser Schwierigkeiten weiter. Der vorwärts sprach mit Sabine Furrer, 41, Sozialarbeiterin für PatientInnen. Sie gehört zu den MitinitiantInnen des Streiks.
Der Streik im Krankenhaus «La Providence» in Neuchâtel hat den 60. Tag überschritten. Die Streikenden geben nicht auf und führen die Mobilisierung trotz grosser Schwierigkeiten weiter. Der vorwärts sprach mit Sabine Furrer, 41, Sozialarbeiterin für PatientInnen. Sie gehört zu den MitinitiantInnen des Streiks.
Aus der aktuellen Printausgabe. Unterstütze uns mit einem Abo.
Am 26. November 2012 habt ihr einen Streik begonnen. Was sind die Gründe?
Die Krankenhausleitung hat einseitig entschieden, den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) aufzukündigen, obwohl er im ganzen Kanton und für die ganze Branche gilt. Wir haben schnell gemerkt, dass damit der Verkauf des Krankenhauses an eine private, börsenkotierte Klinikgruppe in Verbindung stand, die einfach keinen GAV wollte. Die Vermittlungsversuche waren erfolglos und wir hatten keine andere Wahl, als in den Streik zu treten.
Warum streikst du? Was sind deine Gründe?
Ich hätte mir nie vorstellen können, eines Tages zu streiken. Eine Reihe von Ereignissen, die über den Verlust des GAV gehen, haben mich gezwungen, für den Streik einzutreten: Lügen, Böswilligkeit, Manipulation, Drohungen und Druck der Leitung sowie der Opportunismus, die mangelnde Solidarität einiger KollegInnen und kleinen Chefs und der Mangel an Mut von Seiten der PolitikerInnen waren ausschlaggebend. Aber mein zentraler Punkt: Ich konnte mir nicht vorstellen, die anderen an die Front ziehen zu lassen und abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt, ohne mich zu positionieren. Schliesslich ging es mir auch darum, mich gegen das Profitdenken im Gesundheitsbereich einzusetzen.
Welche Schwierigkeiten trefft ihr in eurem Kampf an?
Einerseits haben wir mit einer unglaublichen Kälte zu kämpfen, die das Streiken gar nicht einfach macht, weil der Streikposten ausserhalb des Krankenhauses liegt. Andererseits haben wir grosse Einschüchterungen erlebt: Druck von Seiten der Krankenhausleitung, die behauptete, der Streik sei illegal und die Streikenden riskierten die Kündigung. Zudem wurde die private Sicherheitsfirma «Securitas» angestellt, um eine Barriere zwischen dem Streikposten und dem Krankenhaus zu errichten. Der Leiter der Sicherheit fotografierte die Streikenden, was dazu führte, dass die (noch) nicht Streikenden sich nicht trauten, sich uns anzunähern und mit uns zu diskutieren. So wird es schwierig, im Alltag mit den Stimmungsschwankungen umzugehen.
Warum unterstützt euch die grosse Mehrheit des Krankenhauspersonals nicht?
Viele KollegInnen haben resigniert. Einige haben erklärt, dass sie lieber ihren GAV als ihre Stelle verlieren. Sie haben Angst. Doch mit der Übernahme ist die Auslagerung einiger Bereiche schon geplant. Aus diesen Bereichen beteiligt sich niemand an den Streik, da die KollegInnen denken, dass sie nicht entlassen werden, wenn sie sich als «gute» Angestellte profilieren. Andere haben eine sehr enge Vorstellung der Problematik. Da sie Garantien erhalten haben für den Arbeitsplatzerhalt, stellen sie sich keine Fragen mehr. Dieses individualistische Verhalten ist natürlich auch Ausdruck der aktuellen Krise. Auch sind die finanziellen Aspekte nicht zu unterschätzen: Die Streikenden erhalten keinen Lohn mehr. Wer gewerkschaftlich organisiert ist, kann auf die Streikkasse zählen, die aber nicht den ganzen Lohn deckt. Dann gibt es auch Angestellte, die sich nicht wiedererkennen in unseren Forderungen und in der Bewegung.
Die durch den Streik aufgeworfenen Fragen betreffen auch andere Krankenhäuser, ja gar den gesamten Krankenhaus- und Gesundheitssektor. Habt ihr mit anderen Lohnabhängigen Kontakte herstellen können?
Ehrlich gesagt fühlen wir uns ziemlich isoliert. Die Angestellten der öffentlichen Spitäler in Neuchâtel werden ihren GAV weiterhin beibehalten, sie können sich nicht einmal vorstellen, den GAV zu verlieren.
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Politik gemacht?
Erbärmliche Erfahrungen! Wir mussten uns mit unehrlichen PolitikerInnen konfrontieren, die ihre selbst festgelegten Regeln umgehen, um ihre Ziele zu erreichen. Wir bezahlen gerade den Preis einer zehnjährigen, katastrophalen Regierung – sowohl von rechts, wie auch von links (!) – in Sachen kantonaler Krankenhaus- und Gesundheitspolitik. Ein riesen Schlamassel!
Genolier ist ein grosser Akteur im Krankenhaussektor, der über die Gesundheit seine Profite maximieren will. Worauf müsst ihr euch bei der Übernahme von «La Providence» gefasst machen?
Für die Angestellten bedeutet die Übernahme eine klare Verschlechterung der Arbeitsbedingungen: Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit, Einführung des Leistungslohnes, Senkung der Vergütung für Wochenend- und Nachtarbeit, Überstunden und Ferien. Zudem werden die Leistungen bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft gekürzt. Es sind viele materielle Verschlechterungen. Hinzu kommen die Auslagerungen bestimmter nicht-medizinischer und nicht-pflegerischer Bereiche wie der Wäscherei und der Reinigung. Und schliesslich ist zu erwarten, dass Genolier sich von den teuren Kliniken befreien, um nur noch diejenigen behalten wird, die hohe Profite garantieren.
Während diesen 60 Tagen habt ihr wichtige Erfahrungen in Sachen (Selbst-)Organisation gemacht. Kannst du uns diese Erfahrungen beschreiben?
Wir kommen ständig in Versammlungen zusammen, um über Strategien, Aktionen und die Stossrichtung unseres Kampfes zu entscheiden. Alles funktioniert auf sehr demokratische Art und Weise. Während des Streiks ist die Kommunikation zentral. Wir haben Informationsflugblätter geschrieben, haben sie unseren KollegInnen und der gesamten Bevölkerung verteilt. Zudem haben wir Demonstrationen organisiert, Infostände in der Stadt Neuenburg, aber auch in anderen Städten im Kanton aufgebaut. Dann haben wir auch spezielle Aktionen durchgeführt (Schweige- und Fakelmärsche, Lieder produziert). Interessante Erfahrungen haben wir mit den Medien gemacht: Wir haben Medienkonferenzen durchgeführt, immer wieder Interviews gegeben, um unsere Anliegen zu verbreiten. Aber auch der Kontakt zu den politischen Parteien und den gewählten PolitikerInnen hat nicht gefehl. Wir haben oft vor dem kantonalen Parlament demonstriert.
Welche Rolle spielen die Gewerkschaften in eurem Streik?
Die Gewerkschaften haben eine zentrale und sehr wichtige Rolle. Sie vereinigen die Streikenden und tragen uns auch in einer gewissen Weise. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen in diesem Bereich sind sehr wertvoll. Sie haben die Gewohnheit zu diskutieren, zu verhandeln, den Kontakt zu den Medien zu pflegen. Auch unterstützen sie uns auf der rechtlichen Ebene.
Gibt es auch andere Personen, Organisationen, Kollektive, die euch unterstützen?
Ein Unterstützungskomitee wurde aufgebaut, welches einerseits kollektive Mitglieder zählt (politische Parteien, Organisationen), andererseits individuelle Mitglieder. Sie haben punktuelle Aktionen organisiert. Auch haben wir viele Solidaritätsbotschaften erhalten von Organisationen und Kollektiven aus anderer Regionen. Teilweise haben sie sich auch an unseren Demonstrationen beteiligt.
Welche Bilanz ziehst du aus diesen (ersten) 60 Streiktagen? Und welche Perspektiven hat die Bewegung und der Streik?
Wir haben regelrecht ins Wespennest gestochen. Wir haben den PolitikerInnen gezeigt, dass sie im Krankenhausdossier keine langfristige Vision besitzen. Zudem haben wir gewisse linke Parteien mobilisieren können, die nun ein Gesetzesprojekt, aufbauend auf unseren Forderungen, einreichen wollen. Wir werden unseren Kampf weiterführen, wir lassen unsere Forderungen nicht einfach so fallen. Eine streikende Kollegin hat es mit folgenden Worten bestens auf den Punkt gebracht: «Wir sind der winzige Stein im Schuh, der während den ersten Kilometern keine grossen Sorgen bereitet, aber nach 10 Kilometern unerträglich wird und sich nach 20 Kilometern zu einem regelrechten Felsen wandelt!»
 Der Zürcher Regierungsrat hat dem Kantonsrat beantragt, die Initiative «Steuerbonus für dich» der Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) für ungültig zu erklären. Hat der Regierungsrat Angst vor dem Volksentscheid?
Der Zürcher Regierungsrat hat dem Kantonsrat beantragt, die Initiative «Steuerbonus für dich» der Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) für ungültig zu erklären. Hat der Regierungsrat Angst vor dem Volksentscheid?





 Am Samstag, den 26. Januar 2013 fand in Neuchâtel eine Solidaritätsdemonstration mit den Streikenden von «La Providence» statt. Die Beteiligung war mit über 500 Personen breit. Wir veröffentlichen hier die Rede von Christelle Haussener ab, Pflegerin und Mitinitiantin des Streikes.
Am Samstag, den 26. Januar 2013 fand in Neuchâtel eine Solidaritätsdemonstration mit den Streikenden von «La Providence» statt. Die Beteiligung war mit über 500 Personen breit. Wir veröffentlichen hier die Rede von Christelle Haussener ab, Pflegerin und Mitinitiantin des Streikes. In der «Abzockerinitiative» geht es vor allem um die Umverteilung von Geld innerhalb des Kapitals. Die hoch moralische Debatte legt einige Befindlichkeiten der gutschweizerischen Seele offen. Dass es für die ArbeiterInnen dabei um gar nichts geht, tut der weit verbreiteten Empörung keinen Abbruch.
In der «Abzockerinitiative» geht es vor allem um die Umverteilung von Geld innerhalb des Kapitals. Die hoch moralische Debatte legt einige Befindlichkeiten der gutschweizerischen Seele offen. Dass es für die ArbeiterInnen dabei um gar nichts geht, tut der weit verbreiteten Empörung keinen Abbruch. Referendum gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes mit 63’224 Stimmen eingereicht!
Referendum gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes mit 63’224 Stimmen eingereicht! Die Mächtigen dieser Welt treffen sich vom 23. Bis 27. Januar erneut in Davos. Mit der Hauptparole «resilient dynamism» propagieren sie die Widerstandsfähigkeit des Systems und seiner Akteure gegen all die zu erwartenden Schocks und Katastrophen, eine Widerstandsfähigkeit, welche die Konterrevolution braucht, wie die kriegerische Neuaufteilung der Einflusssphären und die Verschärfung der Ausbeutung weltweit. So kommen die Gastgeber wie die Gäste auch aus allen möglichen Bereichen von Politik und Wirtschaft und illustrieren damit die Einheit von Kapital und Staat: Sei es der «Co-Chair» Axel Weber, Verwaltungsratspräsident der UBS und ehemaliger Präsident der deutschen Bundesbank. War er damals Speerspitze der Austeritätspolitik gegen die südlichen Euro-Länder, ist er heute verantwortlich für die Entlassung von 10?000 Bankangestellten weltweit. Oder sei es der kolumbianischen Präsidenten Santos, verantwortlich für die Ermordung des FARC-Genossen Raúl Reyes in Ecuador 2008. Zur weiteren illustren Gästeschar gehört der neue Weltbank-Präsident Jim Yong Kim, wie auch der kasachische Präsident Nursultan Nazarbajew, Diktator und Herrscher über die landeseigenen Erdgasfelder.
Die Mächtigen dieser Welt treffen sich vom 23. Bis 27. Januar erneut in Davos. Mit der Hauptparole «resilient dynamism» propagieren sie die Widerstandsfähigkeit des Systems und seiner Akteure gegen all die zu erwartenden Schocks und Katastrophen, eine Widerstandsfähigkeit, welche die Konterrevolution braucht, wie die kriegerische Neuaufteilung der Einflusssphären und die Verschärfung der Ausbeutung weltweit. So kommen die Gastgeber wie die Gäste auch aus allen möglichen Bereichen von Politik und Wirtschaft und illustrieren damit die Einheit von Kapital und Staat: Sei es der «Co-Chair» Axel Weber, Verwaltungsratspräsident der UBS und ehemaliger Präsident der deutschen Bundesbank. War er damals Speerspitze der Austeritätspolitik gegen die südlichen Euro-Länder, ist er heute verantwortlich für die Entlassung von 10?000 Bankangestellten weltweit. Oder sei es der kolumbianischen Präsidenten Santos, verantwortlich für die Ermordung des FARC-Genossen Raúl Reyes in Ecuador 2008. Zur weiteren illustren Gästeschar gehört der neue Weltbank-Präsident Jim Yong Kim, wie auch der kasachische Präsident Nursultan Nazarbajew, Diktator und Herrscher über die landeseigenen Erdgasfelder. «Ich bin die neue Bürgermeisterin von Lampedusa. Ich wurde im Mai 2012 gewählt, und bis zum 3. November wurden mir bereits 21 Leichen von Menschen übergeben, die ertrunken sind…, weil sie versuchten, Lampedusa zu erreichen.
«Ich bin die neue Bürgermeisterin von Lampedusa. Ich wurde im Mai 2012 gewählt, und bis zum 3. November wurden mir bereits 21 Leichen von Menschen übergeben, die ertrunken sind…, weil sie versuchten, Lampedusa zu erreichen. Am 7. Januar fand in Bern die Jahresmedienkonferenz des SGB statt.
Am 7. Januar fand in Bern die Jahresmedienkonferenz des SGB statt. Der musikszenische Abend zu Hanns Eisler verknüpft Briefmaterial mit Liedern, in dem über die Persönlichkeit Eislers hinaus die Geschichte des 20.Jahrhunderts erfahrbar wird. Ab Mitte Januar im Cabaret Voltaire in Zürich.
Der musikszenische Abend zu Hanns Eisler verknüpft Briefmaterial mit Liedern, in dem über die Persönlichkeit Eislers hinaus die Geschichte des 20.Jahrhunderts erfahrbar wird. Ab Mitte Januar im Cabaret Voltaire in Zürich. Vor dem Film wird jeweils ein kurzer Überblick zum historischen Kontext und den aktuellen Prozessen gegeben, danach steht Zeit für eine Diskussion mit den Filmemachern zur Verfügung. Für Übersetzung ist gesorgt.
Vor dem Film wird jeweils ein kurzer Überblick zum historischen Kontext und den aktuellen Prozessen gegeben, danach steht Zeit für eine Diskussion mit den Filmemachern zur Verfügung. Für Übersetzung ist gesorgt.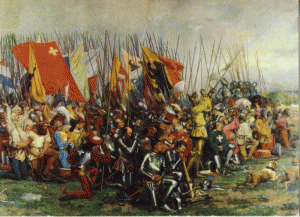 Nun liegt bekanntlich unsere Eidgenossenschaft auch in Europa, sogar mitten drin (geographisch), aber nicht dabei (politisch). Egal. EU hin oder her. Fakt ist, dass wir unsere geliebte Schweiz genauso – wenn nicht noch aggressiver und massiver – abschotten wie die EU mit ihrem Territorium auch tut. Wer es nicht glaubt, soll bitte kurz auf
Nun liegt bekanntlich unsere Eidgenossenschaft auch in Europa, sogar mitten drin (geographisch), aber nicht dabei (politisch). Egal. EU hin oder her. Fakt ist, dass wir unsere geliebte Schweiz genauso – wenn nicht noch aggressiver und massiver – abschotten wie die EU mit ihrem Territorium auch tut. Wer es nicht glaubt, soll bitte kurz auf  Friedensnobelpreis für die Europäische Union? Schlechte Realsatire oder dadaistische Selbstinszenierung, könnte man sich jetzt laut fragen. Oder einfach etwas Balsam auf die krisengeschüttelte Seele der europäischen Zwangsgemeinschaft? Schliesslich hat die EU sonst grad nicht viel zu jubilieren.
Friedensnobelpreis für die Europäische Union? Schlechte Realsatire oder dadaistische Selbstinszenierung, könnte man sich jetzt laut fragen. Oder einfach etwas Balsam auf die krisengeschüttelte Seele der europäischen Zwangsgemeinschaft? Schliesslich hat die EU sonst grad nicht viel zu jubilieren. Am Tag 72 des Referendums gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes über 60’000 Unterschriften gesammelt. Davon wurden bereits 24’000 als gültig beglaubigt. Nichtsdestotrotz sammelt das Komitee auch in den verbleibenden vier Wochen weiter.
Am Tag 72 des Referendums gegen die dringlichen Verschärfungen des Asylgesetzes über 60’000 Unterschriften gesammelt. Davon wurden bereits 24’000 als gültig beglaubigt. Nichtsdestotrotz sammelt das Komitee auch in den verbleibenden vier Wochen weiter.
