 Obwohl Sciencefiction häufig mit so grossen Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells in Verbindung gebracht wird, haftet ihr immer noch der Ruf der Trivialliteratur an. Schnell geschrieben, schnell gelesen und noch viel schneller vergessen. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sie ihren Durchbruch in den USA tatsächlich den Pulpmagazinen verdankt. Diese lockten ihre zumeist junge Leserschaft mit reisserisch gestalteten Titelseiten, die neben abscheulichen Monstern vor allem halbnackte Frauen zeigten. Allerdings sei hier erwähnt, dass diese Magazine jungen und unbekannten Autoren eine Möglichkeit gaben, ihre Werke zu publizieren. Ein weiterer Grund sind die meist sehr oberflächlichen Filmfassungen der Romane. Ein klassisches Beispiel dafür ist H.G. Wells «Die Zeitmaschine». Dass es sich dabei um eine Anklage an die Klassengesellschaft handelt, merkt man beim Film kaum. Auch die Religionskritik in «Planet der Affen», sticht im Film nicht so gut hervor, wie es im Roman der Fall ist. Die Aufwertung des Genres begann 1937 als John W. Campbell Jr. Herausgeber des Pulpmagazin «Astounding» wurde. Während sein Vorgänger Hugo Gernsback grossen wert auf technische Beschreibung und einen einfachen Stil legte, bevorzugte Campbell Geschichten die auch Themen wie Politik, Soziologie und Psychologie behandelten.
Obwohl Sciencefiction häufig mit so grossen Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells in Verbindung gebracht wird, haftet ihr immer noch der Ruf der Trivialliteratur an. Schnell geschrieben, schnell gelesen und noch viel schneller vergessen. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sie ihren Durchbruch in den USA tatsächlich den Pulpmagazinen verdankt. Diese lockten ihre zumeist junge Leserschaft mit reisserisch gestalteten Titelseiten, die neben abscheulichen Monstern vor allem halbnackte Frauen zeigten. Allerdings sei hier erwähnt, dass diese Magazine jungen und unbekannten Autoren eine Möglichkeit gaben, ihre Werke zu publizieren. Ein weiterer Grund sind die meist sehr oberflächlichen Filmfassungen der Romane. Ein klassisches Beispiel dafür ist H.G. Wells «Die Zeitmaschine». Dass es sich dabei um eine Anklage an die Klassengesellschaft handelt, merkt man beim Film kaum. Auch die Religionskritik in «Planet der Affen», sticht im Film nicht so gut hervor, wie es im Roman der Fall ist. Die Aufwertung des Genres begann 1937 als John W. Campbell Jr. Herausgeber des Pulpmagazin «Astounding» wurde. Während sein Vorgänger Hugo Gernsback grossen wert auf technische Beschreibung und einen einfachen Stil legte, bevorzugte Campbell Geschichten die auch Themen wie Politik, Soziologie und Psychologie behandelten.
Die Genres
Seit dieser Zeit hat sich die Sciencefiction rasend schnell entwickelt, und weisst heute eine Vielzahl von Subgenres auf. Generell wird vor allem zwischen «Hard» und «Soft» Sciencefiction unterschieden. Wer die englische Sprache beherrscht, dürfte den Unterschied zwischen den beiden Richtungen bereits kennen. Der Begriff «soft» wird im Englischen dazu verwendet, die weichen Geisteswissenschaften von den exakten beziehungsweise harten Naturwissenschaften abzugrenzen. Während also die Hard-Sciencefiction, vom aktuellen Wissensstand ausgehend, von wissenschaftlicher Genauigkeit und Fakten geprägt ist, dienen technische Errungenschaften in der Soft-Sciencefiction nur als Hilfsmittel, um die Handlung einzubetten. Sie befasst sich auch mehr mit philosophischen, psychologischen, politischen und gesellschaftlichen Themen. Als bekanntester Vertreter der Soft-Sciencefiction kann Stanislaw Lem betrachtet werden, der in seinen Romanen den sowjetischen Materialismus herausforderte. Das für SozialistInnen wohl interessanteste Subgenre dürfte jedoch der Cyberpunk sein. Die Werke meist dystopischer Leseart, enthalten oft eine subtile Kritik an der Gesellschaft und dem Kapitalismus. Verschiedene aktuelle Entwicklungen werden aufgegriffen und in die Zukunft extrapoliert. Zum Beispiel der wachsende Einfluss grosser Konzerne auf die Politik oder die zunehmende staatliche Überwachung.
Der Tausendjahresplan
Kein Artikel über Sciencefiction kommt darum herum, den Mann zu erwähnen, der die Wissenschaft in die Sciencefiction eingeführt hat. Die Rede ist natürlich von Isaac Asimov, der mit dem «Foundation-Zyklus» einen der grossen Meilensteine der Sciencefiction schuf. Den ursprünglichen und zentralen Teil der Reihe bildet die «Foundation-Trilogie». Ausgehend von der Prämisse, dass die Geschichte von sozialen und wirtschaftlichen Kräfteverhältnissen bestimmt wird, entwickelt der Mathematiker Hari Seldon die fiktive Wissenschaft der Psychohistorik. Mittels der Psychohistorik berechnet Seldon die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft. Dabei stellt sich heraus, dass das von den Menschen geschaffene galaktische Imperium zusammenbrechen und ein Zeitalter des Chaos und der Kriege folgen wird. Der Zusammenbruch lässt sich nicht mehr vermeiden, aber das darauf folgende dunkle Zeitalter lässt sich auf tausend Jahre verkürzen. Zu diesem Zweck gründet Seldon, unter dem Vorwand eine Encyclopedia Galactica zu erstellen, eine Kolonie von Wissenschaftlern am Rand der Galaxis, die Foundation. Sie soll den Keim eines stabileren zweiten Imperiums bilden. Damit die Bewohner der Foundation aber nicht von ihrem natürlichen Verhalten und damit dem vorausberechneten Kurs abweichen, erfahren sie nichts Genaues über die Vorhersagen der Psychohistorik. Da Seldon aber nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten konnte, gründet er am entgegengesetzten Ende der Galaxis die zweite Foundation. Ihre Aufgabe besteht darin, die Psychohistorik weiter zu verfeinern und die Einhaltung des Plans zu überwachen.
Der Tolkien der Science Fiction
Ein weiterer Meilenstein der Sciencefiction ist Frank Herberts Wüstenplanet-Zyklus. Am treffendsten wurde der Zyklus von Arthur C. Clarke beschrieben: «Einzigartig in der Charakterisierung und dem Detailreichtum der Darstellung dieser Welt. Neben Tolkiens ‹Herr der Ringe› und diesem Epos kenne ich nichts vergleichbares.» Hinzu kommen noch die Intrigen der hohen Häuser, die durchaus einen Vergleich mit den Werken des grossen William Shakespeare gestatten. Aber die eigentliche Stärke der Bücher sind die Dialoge und inneren Monologe der Hauptfiguren, die tiefe philosophische und religiöse Reflexionen beinhalten. Man kann den Wüstenplanet-Zyklus also auch als Philosophiestudien, verpackt in eine gut durchdachte Sciencefiction-Geschichte, betrachten.
Indem Herbert globale Ereignisse und Entwicklungen seiner Zeit in die Zukunft extrapolierte, schuf er ein ganzes zivilisatorisches Universum, das er bis ins kleinste Detail des alltäglichen Lebens schilderte. Vor dem Hintergrund des Widerspruchs zwischen Ökologie und Ökonomie, entwarf er eine posttechnologische Feudalgesellschaft, in der sich die gesellschaftlich relevanten Themen seiner Zeit direkt oder als Metaphern widerspiegeln. Das zentrale Element des Romans, das Gewürz, ist sowohl eine Metapher für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, als auch für die Erfahrungen mit bewusstseinsverändernden Drogen.
Nun dürfte auch ersichtlich sein, warum die Filme keine Rückschlüsse auf die Bücher gestatten. Obwohl es sich um durchaus ambitionierte Projekte handelte, konnte eine filmische Umsetzung, aufgrund der Komplexität des Stoffes und des begrenzten Budgets, nur mittelmässig ausfallen.
 Die Bauarbeiter sind wütend. Sie können nicht verstehen, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) neun Monate lang mit den Gewerkschaften über einen neuen Landesmantelvertrag verhandelt und am Schluss alles bereits Ausgehandelte vom Tisch wischt. Sie fühlen sich vom SBV nicht ernst genommen. Denn der Bau boomt jetzt seit Jahren und der Druck ist massiv gestiegen: Allein im letzten Jahr ging die Zahl der Beschäftigten um 3,5 Prozent zurück, während der Umsatz um 3,1 Prozent stieg. Die Bauarbeiter bezahlen diesen massiv höheren Druck mit ihrer Gesundheit.
Die Bauarbeiter sind wütend. Sie können nicht verstehen, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) neun Monate lang mit den Gewerkschaften über einen neuen Landesmantelvertrag verhandelt und am Schluss alles bereits Ausgehandelte vom Tisch wischt. Sie fühlen sich vom SBV nicht ernst genommen. Denn der Bau boomt jetzt seit Jahren und der Druck ist massiv gestiegen: Allein im letzten Jahr ging die Zahl der Beschäftigten um 3,5 Prozent zurück, während der Umsatz um 3,1 Prozent stieg. Die Bauarbeiter bezahlen diesen massiv höheren Druck mit ihrer Gesundheit.
 Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) hat am 2. November die Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag (LMV) für das Bauhauptgewerbe scheitern lassen. Statt die aktuellen Probleme zu lösen, will er eine Verlängerung des heute ungenügenden LMV zum Nulltarif. Dagegen wehren sich die Bauarbeiter und ihre Gewerkschaften Unia und Syna. Sie wollen einen LMV mit mehr Schutz und führen darum am kommenden Freitag, 25. November in Genf, Lausanne, Zürich und Bern Protestaktionen durch..
Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) hat am 2. November die Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag (LMV) für das Bauhauptgewerbe scheitern lassen. Statt die aktuellen Probleme zu lösen, will er eine Verlängerung des heute ungenügenden LMV zum Nulltarif. Dagegen wehren sich die Bauarbeiter und ihre Gewerkschaften Unia und Syna. Sie wollen einen LMV mit mehr Schutz und führen darum am kommenden Freitag, 25. November in Genf, Lausanne, Zürich und Bern Protestaktionen durch.. Der vorwärts war anwesend, als am gestrigen Dienstag eine Solidaritätsaktion am Unispital Zürich durchgeführt wurde.
Der vorwärts war anwesend, als am gestrigen Dienstag eine Solidaritätsaktion am Unispital Zürich durchgeführt wurde. Flyertext
Flyertext Mitteilung der AktivistInnen
Mitteilung der AktivistInnen Verschiedene Parteien haben für den Folgetag zu einer neuen Grosskundgebung aufgerufen, nachdem bei den Auseinandersetzungen mehr als 20 Menschen getötet worden sind.
Verschiedene Parteien haben für den Folgetag zu einer neuen Grosskundgebung aufgerufen, nachdem bei den Auseinandersetzungen mehr als 20 Menschen getötet worden sind.
 Weltweit überstürzen sich die Ereignisse im Takt einer Krise, die trotz gegenteiliger Beschwörungen bürgerlicher «ExpertInnen» kein Ende nehmen will und in der Bankrottierung Griechenlands und entsprechenden Verwerfungen im Euro-Raum einen weiteren Höhepunkt zu erreichen droht. Der ökonomischen Krise folgt eine soziale auf den Fuss: Die Verarmungsprogramme der Regierungen bleiben wohl nicht einfach vorübergehende Massnahmen, sondern deuten die Lebensperspektive für die Masse der Verarmten und von der Verarmung Bedrohten an. Das scheint vielen Menschen zu dämmern. In diesem welthistorischen Kontext erblickte vorerst auf den Strassen und Plätzen in Spanien die Bewegung der «Empörten» mit ihrer Forderung nach «echter Demokratie» das Licht der Welt und breitete sich von dort auf weitere Länder aus. Die «Occupy Bewegung», die in New York ihren Ursprung hat und mittlerweile in unzähligen Städten aktiv ist, scheint so etwas wie eine Weiterentwicklung der Bewegung der Empörten zu sein.
Weltweit überstürzen sich die Ereignisse im Takt einer Krise, die trotz gegenteiliger Beschwörungen bürgerlicher «ExpertInnen» kein Ende nehmen will und in der Bankrottierung Griechenlands und entsprechenden Verwerfungen im Euro-Raum einen weiteren Höhepunkt zu erreichen droht. Der ökonomischen Krise folgt eine soziale auf den Fuss: Die Verarmungsprogramme der Regierungen bleiben wohl nicht einfach vorübergehende Massnahmen, sondern deuten die Lebensperspektive für die Masse der Verarmten und von der Verarmung Bedrohten an. Das scheint vielen Menschen zu dämmern. In diesem welthistorischen Kontext erblickte vorerst auf den Strassen und Plätzen in Spanien die Bewegung der «Empörten» mit ihrer Forderung nach «echter Demokratie» das Licht der Welt und breitete sich von dort auf weitere Länder aus. Die «Occupy Bewegung», die in New York ihren Ursprung hat und mittlerweile in unzähligen Städten aktiv ist, scheint so etwas wie eine Weiterentwicklung der Bewegung der Empörten zu sein. Obwohl Sciencefiction häufig mit so grossen Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells in Verbindung gebracht wird, haftet ihr immer noch der Ruf der Trivialliteratur an. Schnell geschrieben, schnell gelesen und noch viel schneller vergessen. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sie ihren Durchbruch in den USA tatsächlich den Pulpmagazinen verdankt. Diese lockten ihre zumeist junge Leserschaft mit reisserisch gestalteten Titelseiten, die neben abscheulichen Monstern vor allem halbnackte Frauen zeigten. Allerdings sei hier erwähnt, dass diese Magazine jungen und unbekannten Autoren eine Möglichkeit gaben, ihre Werke zu publizieren. Ein weiterer Grund sind die meist sehr oberflächlichen Filmfassungen der Romane. Ein klassisches Beispiel dafür ist H.G. Wells «Die Zeitmaschine». Dass es sich dabei um eine Anklage an die Klassengesellschaft handelt, merkt man beim Film kaum. Auch die Religionskritik in «Planet der Affen», sticht im Film nicht so gut hervor, wie es im Roman der Fall ist. Die Aufwertung des Genres begann 1937 als John W. Campbell Jr. Herausgeber des Pulpmagazin «Astounding» wurde. Während sein Vorgänger Hugo Gernsback grossen wert auf technische Beschreibung und einen einfachen Stil legte, bevorzugte Campbell Geschichten die auch Themen wie Politik, Soziologie und Psychologie behandelten.
Obwohl Sciencefiction häufig mit so grossen Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells in Verbindung gebracht wird, haftet ihr immer noch der Ruf der Trivialliteratur an. Schnell geschrieben, schnell gelesen und noch viel schneller vergessen. Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sie ihren Durchbruch in den USA tatsächlich den Pulpmagazinen verdankt. Diese lockten ihre zumeist junge Leserschaft mit reisserisch gestalteten Titelseiten, die neben abscheulichen Monstern vor allem halbnackte Frauen zeigten. Allerdings sei hier erwähnt, dass diese Magazine jungen und unbekannten Autoren eine Möglichkeit gaben, ihre Werke zu publizieren. Ein weiterer Grund sind die meist sehr oberflächlichen Filmfassungen der Romane. Ein klassisches Beispiel dafür ist H.G. Wells «Die Zeitmaschine». Dass es sich dabei um eine Anklage an die Klassengesellschaft handelt, merkt man beim Film kaum. Auch die Religionskritik in «Planet der Affen», sticht im Film nicht so gut hervor, wie es im Roman der Fall ist. Die Aufwertung des Genres begann 1937 als John W. Campbell Jr. Herausgeber des Pulpmagazin «Astounding» wurde. Während sein Vorgänger Hugo Gernsback grossen wert auf technische Beschreibung und einen einfachen Stil legte, bevorzugte Campbell Geschichten die auch Themen wie Politik, Soziologie und Psychologie behandelten. Berechtigte Befürchtungen auf einen Wahlbetrug sind somit vorhanden. Diese lassen mehr als nur vermuten, dass in Lugano, die Hochburg der ‹Lega die Ticinesi›, die Resultate retuschiert wurden, damit der Präsident der FDP/Liberalen, Fulvio Pelli, wieder gewählt wird.» Ein happiger Vorwurf, der vom «Partito Comunista Ticinese» (PCT), der Tessiner Sektion der PdAS, erhoben wird. Die Gründe sind laut den GenossInnen die «Modalitäten, mit denen die Stadt Lugano zu den definitiven Resultaten kam». Diese wurden erst spät in der Nacht bekannt gegeben und wurden dabei «erst noch auf eine waghalsige Art und Weise abgeändert», schreibt der PCT und fügt hinzu: «Als der zweite FDP-Sitz dann doch noch wegen einer Hand voll Stimmen an Fulvio Pelli ging, begann der Verdacht aufzukommen, warum die Bekanntgabe der Resultate sich so ungewöhnlich lang hingezogen hat.»
Berechtigte Befürchtungen auf einen Wahlbetrug sind somit vorhanden. Diese lassen mehr als nur vermuten, dass in Lugano, die Hochburg der ‹Lega die Ticinesi›, die Resultate retuschiert wurden, damit der Präsident der FDP/Liberalen, Fulvio Pelli, wieder gewählt wird.» Ein happiger Vorwurf, der vom «Partito Comunista Ticinese» (PCT), der Tessiner Sektion der PdAS, erhoben wird. Die Gründe sind laut den GenossInnen die «Modalitäten, mit denen die Stadt Lugano zu den definitiven Resultaten kam». Diese wurden erst spät in der Nacht bekannt gegeben und wurden dabei «erst noch auf eine waghalsige Art und Weise abgeändert», schreibt der PCT und fügt hinzu: «Als der zweite FDP-Sitz dann doch noch wegen einer Hand voll Stimmen an Fulvio Pelli ging, begann der Verdacht aufzukommen, warum die Bekanntgabe der Resultate sich so ungewöhnlich lang hingezogen hat.»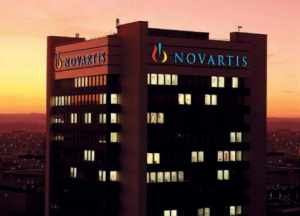 Novartis ist eine wahre Geld-Maschine – auch in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Novartis ein Rekordergebnis: 20 Prozent mehr Umsatz, Reingewinn von über 10 Milliarden
Novartis ist eine wahre Geld-Maschine – auch in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Novartis ein Rekordergebnis: 20 Prozent mehr Umsatz, Reingewinn von über 10 Milliarden Wie die Cham Paper Group mitteilte, soll ein erster Abbauschritt mit der geplanten Stilllegung der Papiermaschine in Cham in der ersten Jahreshälfte 2012 erfolgen und rund 130 Mitarbeiter betreffen. In einem nächsten Schritt werde dann auf Ende 2013 auch die zweite Papiermaschine gestoppt und der Stellenabbau somit per Anfang 2014 vollzogen sein. Ein Grossteil der Produktion wird nach Norditalien
Wie die Cham Paper Group mitteilte, soll ein erster Abbauschritt mit der geplanten Stilllegung der Papiermaschine in Cham in der ersten Jahreshälfte 2012 erfolgen und rund 130 Mitarbeiter betreffen. In einem nächsten Schritt werde dann auf Ende 2013 auch die zweite Papiermaschine gestoppt und der Stellenabbau somit per Anfang 2014 vollzogen sein. Ein Grossteil der Produktion wird nach Norditalien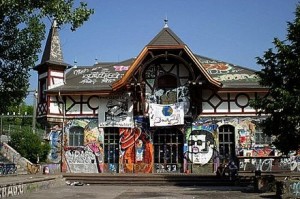 Der Entscheid der Mitterechts-Mehrheit im Stadtrat ist ein Armutszeugnis und ein Angriff auf die Kultur- und Jugendpolitik der Stadt Bern und auf das Verhältnis zwischen Reitschule und Stadt Bern. Dass dabei im
Der Entscheid der Mitterechts-Mehrheit im Stadtrat ist ein Armutszeugnis und ein Angriff auf die Kultur- und Jugendpolitik der Stadt Bern und auf das Verhältnis zwischen Reitschule und Stadt Bern. Dass dabei im Die Gewerkschaft Unia begrüsst diese neue Ausgangslage. Denn noch am 15. November hatte
Die Gewerkschaft Unia begrüsst diese neue Ausgangslage. Denn noch am 15. November hatte
 Der neue italienische Regierungschef Mario Monti, 68 Jahre alt, formell «parteilos», ist alles andere als ein reiner Finanzfachmann und «Technokrat». Der Wirtschaftsprofessor aus Mailand, aus einer Bankiersfamilie
Der neue italienische Regierungschef Mario Monti, 68 Jahre alt, formell «parteilos», ist alles andere als ein reiner Finanzfachmann und «Technokrat». Der Wirtschaftsprofessor aus Mailand, aus einer Bankiersfamilie Mit seinen rund 50 Alben und den 14 Romanen hinterlässt uns der politische Bänkelsänger und Erzähler ein Werk, in dem er uns auf seine Weise, also nach allen Regeln der Kunst, marxistisch stichhaltige Erkenntnisse
Mit seinen rund 50 Alben und den 14 Romanen hinterlässt uns der politische Bänkelsänger und Erzähler ein Werk, in dem er uns auf seine Weise, also nach allen Regeln der Kunst, marxistisch stichhaltige Erkenntnisse