«Du wirst nicht bestraft für das, was du getan hast oder nicht, sondern für das, was du bist.»
Warum stehen wir heute da?
Sicher nicht, wegen des angebrannten Göppels oder ein paar Knallern! Das kann es ja nicht sein!
Die Strafuntersuchung wegen dieses Göppels hatte die Staatsanwaltschaft Zürich schon vor vielen Jahren eingestellt. Der damals zuständige Staatsanwalt meinte im Originalton: «Wir haben gegen niemanden, nicht mal gegen Sie , Ermittlungshandlungen eingeleitet, obwohl sie immer allen zuerst in den Sinn kommen, wenn es irgendwo tätscht!» Und aufdie Frage nach der Bedeutung des Biometrischen Messens: «Das wenden wir nicht an, das ist nur in Indiz um bestenfalls auszuschliessen.»
Nur in Klammern sei erlaubt zu fragen, warum denn das Auto, wenn der Staatschützer ad doch so angriffsrelevant gewesen sein soll, vollbepackt nachts im Freien auf dem Parklplatz steht? Das präziöse Feriengepäck kostete die Versicherung soviel wie das Auto selber! Na ja, nicht so wichtig, es erinnert einfach an die 80er Jahre, wo so mancher mit der gleichen Methode seine Ferien dank Versicherung finanzierte!
Aber kommen wir zur Ausgangsfrage zurück warum wir heute hier sind und fragen uns weiter:
Warum wühlt der Bundesberner Staatsschutz in den Archiven der diversen Staatsanwaltschaften?
Warum beordert mittels vertraulichem Schreiben alle, längst verstaubten und ungelösten
Dossiers politisch motivierter sogenannter «Delikte» in ihre mysteriös arbeitenden Büros, die aus einem üblen Mix zwischen Nachrichtendienst und Polizeiarbeit bestehen ?
Warum ist der Staatsschutz BKP in seinen älteren Sicherheitsberichten, schon fast des Lobes voll über die Militanz der revolutionären Linken, die darauf bedacht sei, im Unterschied zu den damals erstarkten Faschos, nie Menschenleben zu gefährden? Anders heute: Entsprechend ihren Interessen kann aus dem knallenden Lausbubenstreich ein hoch gefährlicher Sprengstoff gezaubert werden.
– Also je nach Bedarf und im Dienste der nachrichtendienstlichen Lageeinschätzern und sogenannte Sicherheitsstrategen!
Der aktuell stattfindende Prozess hat eine lange Vorgeschichte im internationalen, das betrifft unter anderem auch die Rote Hilfe International, wie im nationalen Rahmen. Ob es
ein Resultat der 2006 beschlossenen «neuen Strategie» ist, «die lange Serie der bereits verübten und der zukünftigen noch zu erwartenden «Angriffe» zu unterbrechen» (Bericht über die gerichtspolizeilichen Ermittlungen, H. Uhlmann BKP/Staatsschutz 31.10.2006), entgeht unserer Kenntnis, ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es hier einzig und alleine um revolutionäre Politik, respektive ihre Kriminalisierung geht.
Gestern hat die Bundesanwaltschaft eingangs zwar noch versucht, explizit zu erklären, dass es sich hier nicht um einen politischen Prozess handle. Offensichtlich aber glaubt der BA seinen eigenen Aussagen nicht wirklich. In seinem Plädoyer macht er keinen Hehl daraus, um was es wirklich geht. Haben wir doch gestern von Stadler ausführlich gehört, was auf der Homepage des Aufbaus zu lesen ist, was in den Anschlagserklärungen steht, was ich im Interview in der WOZ formulierte, was für politische Texte bei mir zu finden sind, mit welchen politische Inhalten, revolutionären Gefangenen und ihren Organisationen ich mich beschäftige, und, dass ich eine moderne Marxistin bin.
Damit wird klar, dass es überspitzt gesagt, ihm um das gleiche geht wie mir: um den politischen Kampf! Was uns trennt: eine dazwischen liegende Barrikade.
Unser politische Kampf hat eine lange Kontinuität. Es ist der Kampf um eine Revolutionäre Alternative zum krisengeschüttelten, maroden Kapitalismus, die sich weder stoppen noch unterbrechen lässt! Im Gegenteil. Immer mehr Menschen haben ein System satt, in dem tagtäglich Leute auf die Strasse gestellt werden, die Arbeitshetze für die am Job Verbliebenen steigt und die Sozialleistungen abgebaut werden. Diese Angriffe des Kapitals rücken nicht nur in Griechenland, Spanien, Italien, Israel oder im arabischen Raum ins Zentrum, wo die kapitalistische Krise zu explosionsartigen Ausbrüchen des Klassenzorns führt.
Auch in der Schweiz hat sich die Lage der arbeitenden respektive aus dem Arbeitsprozess Ausgeschlossenen, von den MigrantInnen oder AsylantInnen ganz zu schweigen, in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert, wenn auch nicht, noch nicht in dem Masse, wie zum Beispiel In London. Doch auch hier haben sich die gesellschaftlichen Probleme unter der Oberfläche der heilen CH-Welt längst in breite soziale Felder gefressen. Wenn’s in Zürichs Strassen knallt, wenn da Massen kämpfen, dann staunen wir immer wieder über die Ratlosigkeit der Herrschenden und ihren bizarren Erklärungsversuchen (in London waren es alles Kriminelle, in Zürich ist die Analyse besonders differenziert: aufgeteilt wird in Party, Secondos, Krawalltouristen und 1 Mai-Randalierern!).
Dieser Ratlosigkeit der Herrschenden versucht die BA Herr zu werden. Sie versucht es Beispielsweise mit diesem Verfahren. Denn in diesem Verfahren geht es nicht darum mich als Person für paar Jahre wegzusperren, sondern darum einen Keil zu treiben zwischen den aktiven Revolutionären und der sich politisierenden Jugend.
Auch in diesem Punkt scheint der BA mit uns einig zu gehen. Warum würde er sonst sagen, ich zitiere: «Generalpräventiver Gesichtspunkt … Aus dem eingereichten aktuellen Internetausdruck …rjz.ch geht hervor, dass ein Jugendplenumg des Revolutionären Aufbaus unter dem Namen «Revolutionäre Jugend Zürich» besteht. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass zu milde Strafen potentieller Straftäter oder etwa Jugendliche aus der RJZ zu ähnlichen Delikten ermuntern. Dieser generalpräventive Aspekt zeigt sich aktuell in der Medienberichterstattung im Anschluss an sogenannten Partys!»
Als letztes Aktenstück den Internet-Auszug der RJZ-Homepage ins umfangreiche Dossier legen lassen.
Widerspiegelt wird damit nur eines: Das unlösbare Dilemma der Bourgeoisie, statt rasant wechselnde Krisenbewältigungsszenarien zu erfinden, die Wahre Ursache zu benennen:
den Kapitalismus selbst! Der Kapitalismus, der keine Probleme hat, sondern das Problem IST.
Offensichtlich In keinem Dilemma steckt die Bourgeoisie hingegegen, wenn die Nato der Scharia-Herrschaft in Libyen den Weg frei bombt, dafür im Gegenzug offene Erdölhähne anzapfen darf, bevor der letzte Schuss gefallen ist! Keine Zeile wert ist der Widerspruch zwischen dem Hochjubeln der aufständischen Massen in Tunesien, die angeblich für eine «freiheitliche Demokratie» à la Europa kämpfen würden, und wenn die gleichen TunesierInnen, die nicht bereits auf der Flucht vor Lampedusa ertrunken sind, dann in ihren Lagern beginnen für ihre Rechte zu revoltieren, von den Schergen der Frontex massakriert werden. Wie dies zum wiederholten Male letzte Woche geschah.
Auch in den Metropolen, also in Europa gibt es Revolten, bei denen Leute kriminalisiert, pathologisiert und verunglimpft werden. Auch wenn die Beteiligten zu Beginn oft aus einem Reflex auf die objektiven Bedingungen auf die Strasse gehen und über die gesellschaftlichen Zusammenhänge und politische Ziele im Moment wenig zu sagen haben:
Die Legitimität der Auseinandersetzungen mit dem kapitalistischem Staat, ob in Zürich, London oder Athen steht für uns ausser Frage. Die konkrete und permanente Verbindung dieser und zukünftiger Revolten, der immer wieder aufflackernden Strassenkämpfe, des Widerstands und der Klassenkämpfe mit revolutionären Inhalten, Projekten und Perspektiven ist die wahre explosive Kraft, vor der sich die Herrschenden zurecht fürchten.
Wenn die BA in ihrem Plädoyer zur RJZ von «Generalprävention» spricht, dann meint sie genau das. Das Wegsperren soll genau an dieser Schnittstelle einen Keil treiben! Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die aktuelle gesellschaftliche Situation nicht im Ansatz als revolutionäre Situation bezeichnet werden kann. Das wäre vermessen, idealistisch und weit weg von einer realen Klassenkampfanalyse. Die sozialistische Revolution steht nicht vor der Türe. Nein, es geht um die Perspektive des revolutionären Prozesses – jetzt und morgen, konkret!
Es geht darum, aus der politischen Defensive raus zukommen, in die Offensive zurück zu finden und die Verantwortung in der aktuellen historischen Situation, in der der Kapitalismus mit einer nicht vermuteten Rasanz in den Bankrott rasselt, im revolutionären Prozess zusammen mit anderen Kräften wahrnehmen zu können.
Bankrott bedeutet übrigens leider nicht zwingend den Zusammenbruch, sondern oft Krieg und Elend, wie ein Blick in die Vorgeschichte der zwei Weltkriege zeigt. Oder die Tatsache, dass heute Krieg als Lösung internationaler Widersprüche wieder ins Zentrum imperialistischer Politik gerückt ist. Raus aus der historischen Defensive heisst auch, der Rechtsentwicklung ihren gesellschaftlichen Boden zu entziehen, hinein in die Offensive heisst, unter anderem erstmals starke und konkrete Präsenz entwickeln, aus der heraus eine grundsätzliche und konkrete Kapitalismuskritik die Verbindung zur revolutionären Alternative fassbarer wird.
Es geht darum, in einem konkreten Prozess das objektiv Notwendige mit dem subjektiv Möglichen zu verbinden; sich auf eine Widerspruchsfront raus zu wagen, auf der nicht alle Fragen eine Antwort finden, nicht immer Lösungen für sich stellenden Probleme griffbereit sind, wo Fehler tatsächlich Teil des Aufbauprozesses sind; wo experimentiert und erkämpft wird. Hier, jetzt und konkret – zusammen mit anderen revolutionären Kräften weltweit.
Und dieser langandauernde Kampf für einen revolutionäre Prozess kann auch durch die bürgerlichen Gerichtssäle und Gefängnisse führen, die eben auch unausweichliche Passagen für Militante darstellen können, die sich entschlossen und bewusst in und mit diesem weltweit stattfindenden Kampf entwickeln!
Das ist der wahre Grund, warum ich, als Kommunistin heute (einmal mehr) hier, im Oktober anarchistische Militante in Athen, später wiederum kommunistische Genossen und eine Genossin, in Brüssel vor den Schranken der Klassenjustiz stehen. Jede/r aus einer ihm eigenen politischen-ideologischen Position und eigenen Wahl der Kampfinstrumente heraus, aber bestimmt vereint in der grundsätzlichen Haltung, dass kein bürgerliches Gericht die Legitimität zugesprochen bekommt, diesen Kampf zu be- geschweige denn zu verurteilen. Vereint auch in der Erkenntnis : «Mi – en- leh nannte viele Bedingungen für den Umsturz, aber er wusste keine Zeit, wo nicht an ihm zu arbeiten war» (Bert Brecht)
Mit einem Zitat von Rosa Luxemburg beende ich meine Prozesserklärung und wende ich mich mit ihm an die jungen Zornischen, Widerständischen, politisch Interessierten und ganz speziell an die jungen Militanten der RJZ: «Diejenigen, die sich nicht bewegen, bemerken nicht, ihre Ketten» Und ich möchte dazu fügen: «Diejenigen, die dies erkennen, hingegen versuchen sich aus ihnen zu befreien.»
Bellinzona, 29. September 2011
Andrea Stauffacher
 Dieser Fall steht exemplarisch dafür, dass immer wieder auch in der Schweiz angesiedelte Konzerne im Ausland an sozialen Unruhen und ökologischem Raubbau beteiligt sind. Der neue NGO-Verbund «Recht ohne Grenzen» will dies ändern.
Dieser Fall steht exemplarisch dafür, dass immer wieder auch in der Schweiz angesiedelte Konzerne im Ausland an sozialen Unruhen und ökologischem Raubbau beteiligt sind. Der neue NGO-Verbund «Recht ohne Grenzen» will dies ändern.
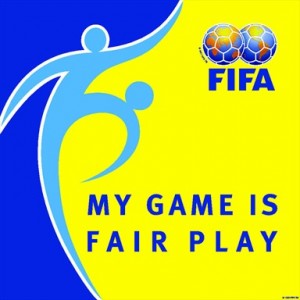 An einer anschliessenden Protestaktion vor dem FIFA-Hauptsitz in Zürich informierten die Gewerkschafter/innen über die in den Gesprächen erreichten Resultate.
An einer anschliessenden Protestaktion vor dem FIFA-Hauptsitz in Zürich informierten die Gewerkschafter/innen über die in den Gesprächen erreichten Resultate.
 «Halleluja, Silvio Berlusconi ist zurückgetreten», schreibt die kommunistische Tageszeitung «il manifesto» in ihrer Ausgabe vom Sonntag, 13. November 2011. Endlich, nach 17 Jahren, verlässt der Medienzar und Multimillionär die politische Bühne Italiens. Sein letzter Gang zum Staatspräsidenten Giorgio Napoletano, bei dem Berlusconi seinen formellen Rücktritt einreichen musste, wurde zum Spiessrutenlauf: Sein Auto und er wurden von wütenden BürgerInnen mit Münzen beworfen. Auf Schildern und Transparenten war zu lesen: «Fertig gehurt», «Game over», «Fertig Party», oder «Danke für den Bankrott», um der Ironie auch noch etwas Platz zu lassen.
«Halleluja, Silvio Berlusconi ist zurückgetreten», schreibt die kommunistische Tageszeitung «il manifesto» in ihrer Ausgabe vom Sonntag, 13. November 2011. Endlich, nach 17 Jahren, verlässt der Medienzar und Multimillionär die politische Bühne Italiens. Sein letzter Gang zum Staatspräsidenten Giorgio Napoletano, bei dem Berlusconi seinen formellen Rücktritt einreichen musste, wurde zum Spiessrutenlauf: Sein Auto und er wurden von wütenden BürgerInnen mit Münzen beworfen. Auf Schildern und Transparenten war zu lesen: «Fertig gehurt», «Game over», «Fertig Party», oder «Danke für den Bankrott», um der Ironie auch noch etwas Platz zu lassen. Neuerdings ist er Vizepräsident des Beratenden Ausschusses der Menschenrechtskommission der Uno, was ihn aber nicht daran hindert, unentwegt den tagtäglichen Skandal des Welthungers in den Medien anzuprangern: soeben ist auf französisch sein neues Buch «Destruction massiv» erschienen, in dem er die neusten Skandale im Bereich der Nahrungsmittelspekulation aufdeckt (siehe unten!). In einem Interview zu seinem 75. Geburtstag, wies er es weit von sich, nun «weise» werden zu wollen. Im Gegenteil: seine Verve in den Diskussionen mit seinen nicht auf den Mund gefallenen GegenspielerInnen und seine Geduld mit BesucherInnen seiner Lesungen nehmen eher noch zu. Wenn er von aggressiven GesprächspartnerInnen unfair angegriffen wird, zieht er höchstens einmal eine Augenbraue hoch oder rückt die riesige, an Frischs und Dürrenmatts Augengläser erinnernde, Brille zurecht: «Monsieur Teflon» hat man ihn auch schon genannt, weil ihn nichts aus der Ruhe bringen kann, er selbst aber die Unruh einer Schweizer Uhr selber ist.
Neuerdings ist er Vizepräsident des Beratenden Ausschusses der Menschenrechtskommission der Uno, was ihn aber nicht daran hindert, unentwegt den tagtäglichen Skandal des Welthungers in den Medien anzuprangern: soeben ist auf französisch sein neues Buch «Destruction massiv» erschienen, in dem er die neusten Skandale im Bereich der Nahrungsmittelspekulation aufdeckt (siehe unten!). In einem Interview zu seinem 75. Geburtstag, wies er es weit von sich, nun «weise» werden zu wollen. Im Gegenteil: seine Verve in den Diskussionen mit seinen nicht auf den Mund gefallenen GegenspielerInnen und seine Geduld mit BesucherInnen seiner Lesungen nehmen eher noch zu. Wenn er von aggressiven GesprächspartnerInnen unfair angegriffen wird, zieht er höchstens einmal eine Augenbraue hoch oder rückt die riesige, an Frischs und Dürrenmatts Augengläser erinnernde, Brille zurecht: «Monsieur Teflon» hat man ihn auch schon genannt, weil ihn nichts aus der Ruhe bringen kann, er selbst aber die Unruh einer Schweizer Uhr selber ist.
 Freiheit und die Chance aufzusteigen, die Möglichkeit, zu?«denen da
Freiheit und die Chance aufzusteigen, die Möglichkeit, zu?«denen da Politische Ziele
Politische Ziele Rund 5000 Personen nahmen am Samstag, dem 1. Oktober, an der gesamtschweizerischen Sans-Papiers-Demo in Bern teil. Der Zusammenschluss der schweizerischen Sans-Papiers-Bewegung forderte dabei eine Abkehr von der heuchlerischen Politik im Umgang mit Sans-Papiers.
Rund 5000 Personen nahmen am Samstag, dem 1. Oktober, an der gesamtschweizerischen Sans-Papiers-Demo in Bern teil. Der Zusammenschluss der schweizerischen Sans-Papiers-Bewegung forderte dabei eine Abkehr von der heuchlerischen Politik im Umgang mit Sans-Papiers.