Die Abstimmung über die Volksinitiative «6 Wochen Freien für alle» hätte für alle Lohnabhängigen, die die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung stellen, Erleichterungen gebracht. Dennoch wurde die Initiative von den StimmbürgerInnen klar abgelehnt. Ein Kommentar zum Abstimmungskampf und seinem leider wenig überraschenden Ausgang.
«Die Schweizer, ein Volk von Vernünftigen», titelte der «Blick am Abend» zur Ablehnung der Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» triumphierend und bewies damit einmal mehr, dass die so hoch gepriesene Objektivität der bürgerlichen Medien eben meist bloss die Objektivität der Herrschenden ist. Doch man kann sich nicht ganz der Einsicht verwehren, dass die StimmbürgerInnen vom Standpunkt der Nationalökonomie in aller Regel tatsächlich vernünftig handeln. Schon in der Vergangenheit zeigten die Stimmberechtigten der Schweiz, was sie von Erleichterungen im Arbeitsalltag halten: 2002 lehnten sie die Initiative für eine 36-Stunden-Woche mit wuchtigen 74 Prozent ab. 2008 schickten sie einen Vorstoss für die Frühpensionierung mit über 58 Prozent bachab. Und nun stimmten 66,5 Prozent dafür, dass die ArbeiterInnen nicht sechs Wochen Ferien zu gute haben sollen. Vor diesem Hintergrund ist das Abstimmungsresultat – auch in dieser Höhe – nicht wirklich erstaunlich.
Der nationale Standort
Die Analyse des Abstimmungsresultats durch PolitologInnen ist relativ einfach zusammenzufassen: Eine millionenschwere Kampagne der Wirtschaftsverbände, wirtschaftliche Unsicherheit und ein geschlossener bürgerlicher Block standen gegen die InitiantInnen. Das lässt man sich in den Medien nun von ExpertInnen lang und breit erklären. Natürlich lässt es sich nicht ganz von der Hand weisen, dass diese Faktoren eine gewichtige Rolle gespielt haben. Doch mit dieser Analyse kratzt man bloss an der Oberfläche der Erscheinungen. Auch der Verweis von GenossInnen, dass bloss ein kleiner Teil der arbeitenden Bevölkerung abgestimmt habe und alle ArbeitsmigrantInnen ohnehin von der Abstimmung ausgeschlossen seien, stimmt zwar, aber sie vermag das Wahlresultat in seiner tieferen Dimension nicht zu erklären.
Warum kann eine so banale Kampagne, wie sie von den VorlagengegnerInnen initiiert worden war, überhaupt derart verfangen? Warum stimmen ArbeiterInnen anscheinend gegen ihre unmittelbaren Interessen? Die Kampagne der Wirtschaftsverbände mit dem so einfachen wie manipulativen Inhalt «Mehr Ferien gleich weniger Arbeitsplätze» setzte auf Denkkategorien, die sich ein guter Teil der abstimmenden Schweizer Bevölkerung längst zu eigen gemacht hat. Vielfach fragt man nicht mehr nach dem eigenen unmittelbaren Interesse, sondern betrachtet die Welt bereits durch den Filter des nationalen Standorts. Was ist gut für die Schweiz? Was bringt «uns» einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den nationalen Konkurrenten? Auch die BefürworterInnen der Initiative liessen sich auf dieses altbekannte Spiel ein: Sechs Wochen Ferien seien für den Wirtschaftsstandort gut und mit ausgeruhten und erholten Arbeitskräften könne man besser wirtschaften.
Es ist für die Initiative und für die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sich objektiv an der Klassengrenze abspielt bereits fatal, wenn man die nationale Kategorie über die der Klasse stellt. Dies spielte im Abstimmungskampfgetöse keine Rolle. Und es war für die Kampagne der InitiantInnen auch nicht relevant, dass es um die Verteilung des Reichtums ging. Darum nämlich, ob die ArbeiterInnen für weniger Arbeit gleichviel des von ihnen produzierten Mehrwerts erhalten sollten. Das ist in der aktuellen Abstimmung wie meist schlicht nicht thematisiert worden. Stattdessen stritt man sich darum, wer denn nun über alle Klassengräben hinweg die Interessen des nationalen Standortes am besten vertreten würde. Auf der einen Seite die InitiantInnen, die mit ausgeruhten ArbeiterInnen argumentierten, auf der anderen Seite die GegnerInnen, die die Wirtschaft durch die zusätzlichen Ferien in Gefahr sah.
Probleme des Klassenkampfs
Was in dieser Abstimmung auf der formell-demokratischen Ebene seinen Ausdruck fand, trifft man auch in der Welt der alltäglichen Arbeitskämpfe an. Streikende und protestierende ArbeiterInnen können «ihr» Unternehmen nicht kaputtstreiken, weil sie damit ihre eigene Lebensgrundlage mitzerstören. Die Reproduktion der Proletarisierten ist in dieser Welt an die Reproduktion des Kapitals gekettet. Dies ist uns an dieser Abstimmung auf der nationalen Ebene begegnet: Die Reproduktionsbedingungen der ArbeiterInnen hängt vom Wohlergehen des nationalen Wirtschaftsstandorts ab. Man darf das nicht falsch verstehen: Deutschland hat als momentaner Krisengewinner gerade vorexerziert, wie ein prima funktionierender Wirtschaftsstandort dennoch Verarmungsprogramme gegen seine ArbeiterInnen durchsetzt. Aber umgekehrt ist es eben so, dass eine kriselnde Wirtschaft ihre Probleme an die Proletarisierten weiter gibt. Und so hat die eigentlich verkehrte Identifikation mit dem nationalen Wirtschaftsstandort tatsächlich sowas wie einen rationalen Kern.
Diesen Kern kann man nicht vom Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft – und darauf stellen sich im Wahl- und Abstimmungskampf praktisch alle – nicht in Frage stellen. Bloss eine Perspektive, die über den Kapitalismus hinausweist, kann solche Basiskategorien in Frage stellen. Allerdings bleibt die Problematik, dass die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen an das Kapital gebunden sind, noch bei aller Kritik bestehen. Abhilfe würde hier lediglich eine reelle praktische Perspektive der Überwindung bieten, wenn die Proletarisierten in Kämpfen die Reproduktion selber und gegen das Kapital zu regeln beginnen.
Wie weiter?
Für eine nächste Abstimmung, die die gesamte Klasse der ArbeiterInnen betrifft, müsste man anerkennen, dass die Mobilisierung gegen objektive Widerstände in Kopf und Herz der grossen Masse der Bevölkerung betrieben werden müsste. Es ist für eine Linke, die grundsätzlich mit dem Kapitalismus brechen will von elementarer Bedeutung, dass die Idee der Nation und des Wirtschaftsstandortes angegriffen und durch die Klassenfrage ersetzt wird. Und so müsste man, wenn man denn auf der Ebene von Abstimmungen intervenieren will, in eine andere Richtung argumentieren: Die Initiative war eine Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zwischen jenen, die den Mehrwert produzieren und jenen die ihn sich aneignen. Die Initiative war direkt an die Klassenfrage geknüpft und diese Frage lässt sich konsequent vertreten und zumindest in der Krise mit nationalen Kategorien nicht vereinbaren. über die Volksinitiative «6 Wochen Freien für alle» hätte für alle Lohnabhängigen, die die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung stellen, Erleichterungen gebracht. Dennoch wurde die Initiative von den StimmbürgerInnen klar abgelehnt. Ein Kommentar zum Abstimmungskampf und seinem leider wenig überraschenden Ausgang.
«Die Schweizer, ein Volk von Vernünftigen», titelte der «Blick am Abend» zur Ablehnung der Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» triumphierend und bewies damit einmal mehr, dass die so hoch gepriesene Objektivität der bürgerlichen Medien eben meist bloss die Objektivität der Herrschenden ist. Doch man kann sich nicht ganz der Einsicht verwehren, dass die StimmbürgerInnen vom Standpunkt der Nationalökonomie in aller Regel tatsächlich vernünftig handeln. Schon in der Vergangenheit zeigten die Stimmberechtigten der Schweiz, was sie von Erleichterungen im Arbeitsalltag halten: 2002 lehnten sie die Initiative für eine 36-Stunden-Woche mit wuchtigen 74 Prozent ab. 2008 schickten sie einen Vorstoss für die Frühpensionierung mit über 58 Prozent bachab. Und nun stimmten 66,5 Prozent dafür, dass die ArbeiterInnen nicht sechs Wochen Ferien zu gute haben sollen. Vor diesem Hintergrund ist das Abstimmungsresultat – auch in dieser Höhe – nicht wirklich erstaunlich. Der nationale Standort Die Analyse des Abstimmungsresultats durch PolitologInnen ist relativ einfach zusammenzufassen: Eine millionenschwere Kampagne der Wirtschaftsverbände, wirtschaftliche Unsicherheit und ein geschlossener bürgerlicher Block standen gegen die InitiantInnen. Das lässt man sich in den Medien nun von ExpertInnen lang und breit erklären. Natürlich lässt es sich nicht ganz von der Hand weisen, dass diese Faktoren eine gewichtige Rolle gespielt haben. Doch mit dieser Analyse kratzt man bloss an der Oberfläche der Erscheinungen. Auch der Verweis von GenossInnen, dass bloss ein kleiner Teil der arbeitenden Bevölkerung abgestimmt habe und alle ArbeitsmigrantInnen ohnehin von der Abstimmung ausgeschlossen seien, stimmt zwar, aber sie vermag das Wahlresultat in seiner tieferen Dimension nicht zu erklären. Warum kann eine so banale Kampagne, wie sie von den VorlagengegnerInnen initiiert worden war, überhaupt derart verfangen? Warum stimmen ArbeiterInnen anscheinend gegen ihre unmittelbaren Interessen? Die Kampagne der Wirtschaftsverbände mit dem so einfachen wie manipulativen Inhalt «Mehr Ferien gleich weniger Arbeitsplätze» setzte auf Denkkategorien, die sich ein guter Teil der abstimmenden Schweizer Bevölkerung längst zu eigen gemacht hat. Vielfach fragt man nicht mehr nach dem eigenen unmittelbaren Interesse, sondern betrachtet die Welt bereits durch den Filter des nationalen Standorts. Was ist gut für die Schweiz? Was bringt «uns» einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den nationalen Konkurrenten? Auch die BefürworterInnen der Initiative liessen sich auf dieses altbekannte Spiel ein: Sechs Wochen Ferien seien für den Wirtschaftsstandort gut und mit ausgeruhten und erholten Arbeitskräften könne man besser wirtschaften. Es ist für die Initiative und für die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sich objektiv an der Klassengrenze abspielt bereits fatal, wenn man die nationale Kategorie über die der Klasse stellt. Dies spielte im Abstimmungskampfgetöse keine Rolle. Und es war für die Kampagne der InitiantInnen auch nicht relevant, dass es um die Verteilung des Reichtums ging. Darum nämlich, ob die ArbeiterInnen für weniger Arbeit gleichviel des von ihnen produzierten Mehrwerts erhalten sollten. Das ist in der aktuellen Abstimmung wie meist schlicht nicht thematisiert worden. Stattdessen stritt man sich darum, wer denn nun über alle Klassengräben hinweg die Interessen des nationalen Standortes am besten vertreten würde. Auf der einen Seite die InitiantInnen, die mit ausgeruhten ArbeiterInnen argumentierten, auf der anderen Seite die GegnerInnen, die die Wirtschaft durch die zusätzlichen Ferien in Gefahr sah. Probleme des Klassenkampfs Was in dieser Abstimmung auf der formell-demokratischen Ebene seinen Ausdruck fand, trifft man auch in der Welt der alltäglichen Arbeitskämpfe an. Streikende und protestierende ArbeiterInnen können «ihr» Unternehmen nicht kaputtstreiken, weil sie damit ihre eigene Lebensgrundlage mitzerstören. Die Reproduktion der Proletarisierten ist in dieser Welt an die Reproduktion des Kapitals gekettet. Dies ist uns an dieser Abstimmung auf der nationalen Ebene begegnet: Die Reproduktionsbedingungen der ArbeiterInnen hängt vom Wohlergehen des nationalen Wirtschaftsstandorts ab. Man darf das nicht falsch verstehen: Deutschland hat als momentaner Krisengewinner gerade vorexerziert, wie ein prima funktionierender Wirtschaftsstandort dennoch Verarmungsprogramme gegen seine ArbeiterInnen durchsetzt. Aber umgekehrt ist es eben so, dass eine kriselnde Wirtschaft ihre Probleme an die Proletarisierten weiter gibt. Und so hat die eigentlich verkehrte Identifikation mit dem nationalen Wirtschaftsstandort tatsächlich sowas wie einen rationalen Kern. Diesen Kern kann man nicht vom Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft – und darauf stellen sich im Wahl- und Abstimmungskampf praktisch alle – nicht in Frage stellen. Bloss eine Perspektive, die über den Kapitalismus hinausweist, kann solche Basiskategorien in Frage stellen. Allerdings bleibt die Problematik, dass die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen an das Kapital gebunden sind, noch bei aller Kritik bestehen. Abhilfe würde hier lediglich eine reelle praktische Perspektive der Überwindung bieten, wenn die Proletarisierten in Kämpfen die Reproduktion selber und gegen das Kapital zu regeln beginnen. Wie weiter? Für eine nächste Abstimmung, die die gesamte Klasse der ArbeiterInnen betrifft, müsste man anerkennen, dass die Mobilisierung gegen objektive Widerstände in Kopf und Herz der grossen Masse der Bevölkerung betrieben werden müsste. Es ist für eine Linke, die grundsätzlich mit dem Kapitalismus brechen will von elementarer Bedeutung, dass die Idee der Nation und des Wirtschaftsstandortes angegriffen und durch die Klassenfrage ersetzt wird. Und so müsste man, wenn man denn auf der Ebene von Abstimmungen intervenieren will, in eine andere Richtung argumentieren: Die Initiative war eine Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zwischen jenen, die den Mehrwert produzieren und jenen die ihn sich aneignen. Die Initiative war direkt an die Klassenfrage geknüpft und diese Frage lässt sich konsequent vertreten und zumindest in der Krise mit nationalen Kategorien nicht vereinbaren.>Die über die Volksinitiative «6 Wochen Freien für alle» hätte für alle Lohnabhängigen, die die Mehrheitder Schweizer Bevölkerung stellen, Erleichterungen gebracht. Dennoch wurde die Initiative von den StimmbürgerInnen klar abgelehnt. Ein Kommentar zum Abstimmungskampf und seinem leider wenig überraschenden Ausgang.
«Die Schweizer, ein Volk von Vernünftigen», titelte der «Blick am Abend» zur Ablehnung der Volksinitiative «6 Wochen Ferien für alle» triumphierend und bewies damit einmal mehr, dass die so hoch gepriesene Objektivität der bürgerlichen Medien eben meist bloss die Objektivität der Herrschenden ist. Doch man kann sich nicht ganz der Einsicht verwehren, dass die StimmbürgerInnen vom Standpunkt der Nationalökonomie in aller Regel tatsächlich vernünftig handeln. Schon in der Vergangenheit zeigten die Stimmberechtigten der Schweiz, was sie von Erleichterungen im Arbeitsalltag halten: 2002 lehnten sie die Initiative für eine 36-Stunden-Woche mit wuchtigen 74 Prozent ab. 2008 schickten sie einen Vorstoss für die Frühpensionierung mit über 58 Prozent bachab. Und nun stimmten 66,5 Prozent dafür, dass die ArbeiterInnen nicht sechs Wochen Ferien zu gute haben sollen. Vor diesem Hintergrund ist das Abstimmungsresultat – auch in dieser Höhe – nicht wirklich erstaunlich.
Der nationale Standort
Die Analyse des Abstimmungsresultats durch PolitologInnen ist relativ einfach zusammenzufassen: Eine millionenschwere Kampagne der Wirtschaftsverbände, wirtschaftliche Unsicherheit und ein geschlossener bürgerlicher Block standen gegen die InitiantInnen. Das lässt man sich in den Medien nun von ExpertInnen lang und breit erklären. Natürlich lässt es sich nicht ganz von der Hand weisen, dass diese Faktoren eine gewichtige Rolle gespielt haben. Doch mit dieser Analyse kratzt man bloss an der Oberfläche der Erscheinungen. Auch der Verweis von GenossInnen, dass bloss ein kleiner Teil der arbeitenden Bevölkerung abgestimmt habe und alle ArbeitsmigrantInnen ohnehin von der Abstimmung ausgeschlossen seien, stimmt zwar, aber sie vermag das Wahlresultat in seiner tieferen Dimension nicht zu erklären.
Warum kann eine so banale Kampagne, wie sie von den VorlagengegnerInnen initiiert worden war, überhaupt derart verfangen? Warum stimmen ArbeiterInnen anscheinend gegen ihre unmittelbaren Interessen? Die Kampagne der Wirtschaftsverbände mit dem so einfachen wie manipulativen Inhalt «Mehr Ferien gleich weniger Arbeitsplätze» setzte auf Denkkategorien, die sich ein guter Teil der abstimmenden Schweizer Bevölkerung längst zu eigen gemacht hat. Vielfach fragt man nicht mehr nach dem eigenen unmittelbaren Interesse, sondern betrachtet die Welt bereits durch den Filter des nationalen Standorts. Was ist gut für die Schweiz? Was bringt «uns» einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den nationalen Konkurrenten? Auch die BefürworterInnen der Initiative liessen sich auf dieses altbekannte Spiel ein: Sechs Wochen Ferien seien für den Wirtschaftsstandort gut und mit ausgeruhten und erholten Arbeitskräften könne man besser wirtschaften.
Es ist für die Initiative und für die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sich objektiv an der Klassengrenze abspielt bereits fatal, wenn man die nationale Kategorie über die der Klasse stellt. Dies spielte im Abstimmungskampfgetöse keine Rolle. Und es war für die Kampagne der InitiantInnen auch nicht relevant, dass es um die Verteilung des Reichtums ging. Darum nämlich, ob die ArbeiterInnen für weniger Arbeit gleichviel des von ihnen produzierten Mehrwerts erhalten sollten. Das ist in der aktuellen Abstimmung wie meist schlicht nicht thematisiert worden. Stattdessen stritt man sich darum, wer denn nun über alle Klassengräben hinweg die Interessen des nationalen Standortes am besten vertreten würde. Auf der einen Seite die InitiantInnen, die mit ausgeruhten ArbeiterInnen argumentierten, auf der anderen Seite die GegnerInnen, die die Wirtschaft durch die zusätzlichen Ferien in Gefahr sah.
Probleme des Klassenkampfs
Was in dieser Abstimmung auf der formell-demokratischen Ebene seinen Ausdruck fand, trifft man auch in der Welt der alltäglichen Arbeitskämpfe an. Streikende und protestierende ArbeiterInnen können «ihr» Unternehmen nicht kaputtstreiken, weil sie damit ihre eigene Lebensgrundlage mitzerstören. Die Reproduktion der Proletarisierten ist in dieser Welt an die Reproduktion des Kapitals gekettet. Dies ist uns an dieser Abstimmung auf der nationalen Ebene begegnet: Die Reproduktionsbedingungen der ArbeiterInnen hängt vom Wohlergehen des nationalen Wirtschaftsstandorts ab. Man darf das nicht falsch verstehen: Deutschland hat als momentaner Krisengewinner gerade vorexerziert, wie ein prima funktionierender Wirtschaftsstandort dennoch Verarmungsprogramme gegen seine ArbeiterInnen durchsetzt. Aber umgekehrt ist es eben so, dass eine kriselnde Wirtschaft ihre Probleme an die Proletarisierten weiter gibt. Und so hat die eigentlich verkehrte Identifikation mit dem nationalen Wirtschaftsstandort tatsächlich sowas wie einen rationalen Kern.
Diesen Kern kann man nicht vom Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft – und darauf stellen sich im Wahl- und Abstimmungskampf praktisch alle – nicht in Frage stellen. Bloss eine Perspektive, die über den Kapitalismus hinausweist, kann solche Basiskategorien in Frage stellen. Allerdings bleibt die Problematik, dass die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen an das Kapital gebunden sind, noch bei aller Kritik bestehen. Abhilfe würde hier lediglich eine reelle praktische Perspektive der Überwindung bieten, wenn die Proletarisierten in Kämpfen die Reproduktion selber und gegen das Kapital zu regeln beginnen.
Wie weiter?
Für eine nächste Abstimmung, die die gesamte Klasse der ArbeiterInnen betrifft, müsste man anerkennen, dass die Mobilisierung gegen objektive Widerstände in Kopf und Herz der grossen Masse der Bevölkerung betrieben werden müsste. Es ist für eine Linke, die grundsätzlich mit dem Kapitalismus brechen will von elementarer Bedeutung, dass die Idee der Nation und des Wirtschaftsstandortes angegriffen und durch die Klassenfrage ersetzt wird. Und so müsste man, wenn man denn auf der Ebene von Abstimmungen intervenieren will, in eine andere Richtung argumentieren: Die Initiative war eine Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums zwischen jenen, die den Mehrwert produzieren und jenen die ihn sich aneignen. Die Initiative war direkt an die Klassenfrage geknüpft und diese Frage lässt sich konsequent vertreten und zumindest in der Krise mit nationalen Kategorien nicht vereinbaren.


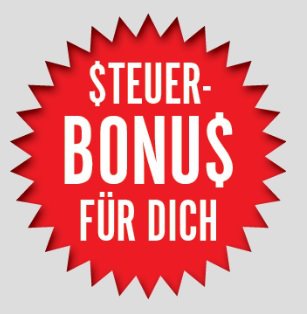 Die kantonale Volksinitiative «Steuerbonus für dich» will das Privatvermögen ab 3 Millionen und das Eigenkapital der Firmen ab 5 Millionen Franken mit 1 Prozent besteuern. Dies ergibt Steuereinnahmen von rund 6 Milliarden Franken. Diese Summe verteilen wir mit einem Steuerbonus von 5 000 Franken pro Erwachsenen und 3 000 Franken pro Kind. 80 Prozent der Bevölkerung profitiert davon. Wenig für wenige, viel für Viele. Unterschreibt die Initiative der Partei der Arbeit Zürich (PdAZ)!
Die kantonale Volksinitiative «Steuerbonus für dich» will das Privatvermögen ab 3 Millionen und das Eigenkapital der Firmen ab 5 Millionen Franken mit 1 Prozent besteuern. Dies ergibt Steuereinnahmen von rund 6 Milliarden Franken. Diese Summe verteilen wir mit einem Steuerbonus von 5 000 Franken pro Erwachsenen und 3 000 Franken pro Kind. 80 Prozent der Bevölkerung profitiert davon. Wenig für wenige, viel für Viele. Unterschreibt die Initiative der Partei der Arbeit Zürich (PdAZ)! Hinter dem so genannten ACTA-Abkommen verbergen sich weit gravierendere Gefahren als die blosse Einschränkung der Meinungs- und Downloadfreiheit im Internet. An diesem Abkommen zeigt sich eine grundlegende Problematik der bürgerlichen Gesellschaft und dem ihr notwendig innewohnenden Ausschluss bestimmter Menschengruppen vom gesellschaftlichen Reichtum. Auch der Bundesrat und das Parlament werden sich damit befassen müssen.
Hinter dem so genannten ACTA-Abkommen verbergen sich weit gravierendere Gefahren als die blosse Einschränkung der Meinungs- und Downloadfreiheit im Internet. An diesem Abkommen zeigt sich eine grundlegende Problematik der bürgerlichen Gesellschaft und dem ihr notwendig innewohnenden Ausschluss bestimmter Menschengruppen vom gesellschaftlichen Reichtum. Auch der Bundesrat und das Parlament werden sich damit befassen müssen. Ralf Streck. Am 23. März kommt es in Spanien zum sechsten Generalstreik seit Ende der Diktatur im Jahr 1975. Die Gewerkschaften mobilisieren gegen die neue Arbeitsreform der bürgerlichen Regierung. Diese führt unter anderem zu einer Durchlöcherung des Kündigungsschutzes. Am Sonntag, 13. März, haben die Gewerkschaften die Hauptprobe für den Generalstreik durchgeführt.
Ralf Streck. Am 23. März kommt es in Spanien zum sechsten Generalstreik seit Ende der Diktatur im Jahr 1975. Die Gewerkschaften mobilisieren gegen die neue Arbeitsreform der bürgerlichen Regierung. Diese führt unter anderem zu einer Durchlöcherung des Kündigungsschutzes. Am Sonntag, 13. März, haben die Gewerkschaften die Hauptprobe für den Generalstreik durchgeführt. .
.

