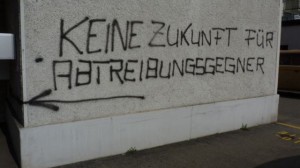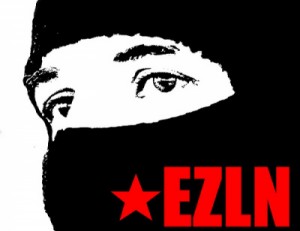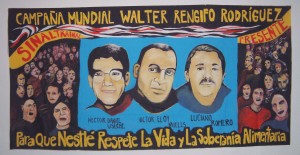Dieudonnés Irrungen und Wirrungen
 Anfangs Februar gastiert der französische «Komiker» Dieudonné M‘bala M‘bala mit seiner Show in Nyon. Mit dem Versprechen, sich an die hiesigen Gesetze zu halten und antisemitische Äusserungen zu unterlassen, wurden ihm die Auftritte durch die Stadtverwaltung gewährt. Doch genau hinschauen lohnt sich, denn hinter Dieudonné steckt weit mehr als dessen antisemitische Tiraden vermuten lassen.
Anfangs Februar gastiert der französische «Komiker» Dieudonné M‘bala M‘bala mit seiner Show in Nyon. Mit dem Versprechen, sich an die hiesigen Gesetze zu halten und antisemitische Äusserungen zu unterlassen, wurden ihm die Auftritte durch die Stadtverwaltung gewährt. Doch genau hinschauen lohnt sich, denn hinter Dieudonné steckt weit mehr als dessen antisemitische Tiraden vermuten lassen.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich der französisch-kamerunische «Komiker» Dieudonné M›bala M›bala aufgrund seiner Show Vorwürfe bezüglich Rassismus und Antisemitismus anhören muss. Gegen ihn erhobene Anschuldigungen wusste Dieudonné stets mit einer «man wird ja wohl noch sagen dürfen»-Mentalität entgegenzutreten und fand dabei freudigen Anklang in der vereinigten Wutbürgerschaft. Nachdem Dieudonné jedoch einem jüdischen Journalisten nachrief, es sei schade, dass dieser nicht in den Gaskammern umgekommen sei, setzte die französische Regierung dem Spuck vorübergehend ein Ende und verbot kurzfristig weitere Aufritte des «Komikers».
Dieudonné näherte sich seit der Jahrtausendwende immer mehr der politischen Rechten an. Dadurch wandelten sich auch dessen Auftritte. Einst für die Rechte der MigrantInnen eintretend, richten sich die Stücke heute, wenn es für einmal nicht um Juden oder Geschichtsrevisionismus geht, hauptsächlich gegen die als ungerecht empfundenen Taten der Pariser Zentralregierung. Dieudonné vermag mit solchen klaren politischen Ansagen gemixt mit debilem Sandkastenhumor sowohl die politisch unzufriedene BürgerIn, wie auch den gestandenen Fussballprofi hinter sich zu scharen.
Vom «Komiker» zum Politiker
Nachdem seine eigene Präsidentschaftskandidatur 2007 aufgrund interner Probleme scheiterte, rief Dieudonné für die Europaratswahlen 2009 eine «antizionistische Liste» ins Leben. Darauf kandidierten sowohl VertreterInnen der extremen Rechten und bekannte HolocaustleugnerInnen als auch Personen aus der schiitischen Fundamentalistengruppe «Centre Zahra». Natürlich ist Antizionismus nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen und kann in Kombination mit progressiven Ideen durchaus ein legitimer Ausdruck eines regionalen Kampfes gegen die nationalstaatliche Ideologie Israels darstellen. Wer aber im Herzen Europas den Zionismus als einen nebulösen Hauptfeind ausmacht, der leidet im besten Fall unter paranoiden Wahnvorstellungen, eher aber unter einem klassischen Antisemitismus.
Dieudonnés neuster politischer Streich ist der «Quenelle-Gruss». Die eine Hand auf die Schulter, den anderen Arm stramm zum Boden gestreckt, gilt die Begrüssung sowohl als Ausdruck einer diffusen Protestbewegung als auch als verdeckter Hitlergruss. Wie schon die Querfront der «antizionistischen Liste» vermag auch der «Quenelle-Gruss» neue Brücken zu schlagen. Dieudonnés Hasstiraden richten sich gegen «die da oben», der Chor der politisch Unzufriedenen steigt gerne mit ein und mit dem erfundenen Gruss haben beide ein gemeinsames Protestsymbol. Wird Dieudonné nun vom französischen Rechtsstaat angegangen, dann erscheint dies auch als politischer Angriff des Pariser Establishments auf die neue Protestkultur. Die diffuse Abneigung gegen das politische System und die anhaltende wirtschaftliche Krise verbrüdern unterschiedliche soziale Kräfte. Dieudonné wird so, ob gewollt oder nicht, kultureller und politischer Ausdruck einer solchen Protestbewegung.
Kontakte zur extremen Rechten
Dieudonné selbst vermochte nach seinem politischen Wandel innerhalb kurzer Zeit mit unzähligen VertreterInnen des französischen Neorassismus in Kontakt zu treten. So liest sich dessen Bekanntenliste wie ein Who is Who des französischen Rechtsextremismus. Eine enge Freundschaft besteht mit Alain Soral, der wohl auch der wichtigste politische Kopf hinter Dieudonné ist. Dieser verlies 2009 das Zentralkomitee des Front National, weil ihm die Partei zu «angepasst» erschien, und kandidierte daraufhin auf der Liste von Dieudonné. 2008 liess Dieudonné den bekannten Holocaustleugner Robert Faurisson auf der Bühne auftreten. Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front National, ist Taufpate seines dritten Kindes. Die Zeremonie wurde vom selben Kleriker durchgeführt, der auch schon die Totenmesse für den Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher Paul Touvier hielt. Auch mit weiteren Rechtsextremen Splittergrüppchen steht Dieudonné auf Tuchfühlung. So veröffentlichte er am 30. Juli dieses Jahres ein Interview mit Serge Ayoub auf YouTube. Ayoub gilt als Anführer der neofaschistischen Gruppierungen «Jeunesses nationalistes révolutionnaires» und «Troisième Voie», die beide mit dem Mord am jungen Antifaschisten Clément Méric am 5. Juni in Paris in Verbindung gebracht und mittlerweile gerichtlich verboten wurden. Ayoub und Dieudonné gehen in dem 30-minütigen Interview einig darin, dass eigentlich ein jedes Volk seinen Platz auf der Erde habe. Die völkische Tradition verbindet, so dass die Liaison der beiden Provokateure schliesslich mit einem fröhlichen Handschlag gefestigt werden kann.
Schweizerische Problembewältigung
Vom 3. bis zum 5. Februar und vom 3. bis zum 4. März lädt Dieudonné nun zu insgesamt zehn Shows in Nyon. Die Stadtverwaltung kam nach längerem Hin und Her zum Entschluss das zu tun, was die Schweiz in solchen Fällen stets zu tun pflegt: das ganze zu einer rechtlichen Frage zu degradieren. Solange die Show nicht explizit gegen die hiesigen Gesetze verstösst, darf sie stattfinden. Dieudonné eifrig darum bemüht, wenigstens einige Aufführungen seiner aktuellen Tour durchführen zu können, akzeptiert diese Entscheidung. Er lässt aus Wohlwollen darüber geschichtsrevisionistische Showelemente aus und verspricht dafür, den Akzent auf die Verballhornung des afrikanischen Kontinentes zu legen. Dass das Problem Dieudonné nicht nur an den geäusserten Worten, sondern an dessen Person und Handeln selbst festzumachen ist, negiert eine solche Scheinlösung. Dieudonné ist auch dann noch ein Rassist, wenn er für einige Auftritte seine Tiraden unterlässt.
Natürlich kann es hierbei nicht darum gehen, den Staat zum Handeln aufzufordern. Die gesellschaftliche Diskussion über Rassismus muss von unten kommen. Es kann dabei aber auch nicht, wie der Rapper Stress kürzlich auf Facebook als Werbung für Dieudonnés Veranstaltung schrieb, um die Verteidigung der freien Meinungsäusserung gehen. So platt die Parole «Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen» nach unzähliger Verwendung schon erscheinen mag, so wahr ist sie dennoch. Dieudonné hat in Nyon nichts zu suchen und zwar nicht weil er gegen allfällige Gesetze verstösst, sondern weil Rassisten jeglicher politischer Farbe das Leben schwer gemacht werden sollte.
Aus der aktuellen Printausgabe. Unterstütze uns mit einem Abo