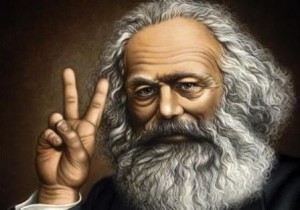Die PdA Zürich hat eine städtische Initiative lanciert für kostenlose Bade- und Sportanlagen und will nächstes Jahr an den Gemeinderatswahlen teilnehmen. Ein Gespräch mit Nesrin Ulu, PdA-Spitzenkandidatin für den Kreis 3.
Die PdA Zürich hat eine städtische Initiative lanciert für kostenlose Bade- und Sportanlagen und will nächstes Jahr an den Gemeinderatswahlen teilnehmen. Ein Gespräch mit Nesrin Ulu, PdA-Spitzenkandidatin für den Kreis 3.
Die Partei der Arbeit (PdA) Zürich hat die Volksinitiative «Sportstadt Züri» lanciert. Worum geht es?
Mit der Initiative soll der Zugang zu allen Bade- und Sportanlagen der Stadt Zürich kostenlos werden. Grundsätzlich geht es für uns darum, dass Menschen mit kleinem Einkommen, Jugendliche und Kinder in der Stadt Zürich kein Geld zahlen müssen, um Sport zu treiben. Ich habe sehr lange als Familienbegleiterin gearbeitet; mehrheitlich mit Familien, die Sozialhilfeleistungen beziehen müssen und sehr wenig Einkommen haben durch ihre Arbeit. Dabei habe ich festgestellt, dass es für die Familien eine enorme Belastung ist, wenn die Kinder in die Badeanlagen gehen wollen. In Zürich kostet es für Kinder 4 Franken pro Eintritt. Das hört sich nach wenig an; für Familien, die ein tiefes Einkommen oder nur Sozialhilfe haben, ist es aber sehr belastend. Man muss rechnen: 4 Franken kostet der Eintritt, das Kind will vielleicht dort noch etwas trinken oder essen, und wenn sie zwei-, dreimal in der Woche in die Badi gehen, dann kostet das schon Einiges. Da müssen die Eltern deshalb oft Nein sagen, weil sie kein Geld dafür haben. Ich unterstütze diese Initiative deshalb vollständig. Die Initiative hilft auch den kleinen Sportvereinen, indem die Benutzungsgebühren für die städtischen Sportanlagen abgeschafft werden, was ich auch sehr wichtig finde. Ich habe selber zwei Kinder. Mein Sohn hat Fussball gespielt in einem solchen Verein. Dabei habe ich miterlebt, wie viele Leute dort involviert waren und wie sie wertvolle Arbeit leisteten. Sie hatten aber immer ein sehr knappes Budget. Durch die Initiative können solche Vereine mit diesen Menschen, die für unsere Kinder freiwillige Arbeit leisten, ihre finanzielle Situation verbessern. Sie müssen nicht mehr immer streng auf das Budget achtgeben und können freier den Sport für die Kinder und Jugendlichen organisieren.
Eine Frage, die sich bei dieser Initiative stellt, ist, wie viel die Umsetzung kosten würde und wie sie finanziert werden soll?
Der Betrag, der dem Budget der Stadt Zürich dadurch entfällt, ist nicht enorm gross. Ihr Gesamtbudget umfasst 8,7 Milliarden Franken. Sie subventioniert ihre Sportanlagen bereits heute im Durchschnitt zu fast 85 Prozent. Laut Sportamt wird die Initiative unter 15 Millionen Franken kosten. Das sind weniger als 0,2 Prozent des Gesamtbudgets. Aus meiner Sicht ist es definitiv machbar. Besonders wenn man es vergleicht mit dem, was in die Prävention von Drogenkonsum und Gewalt unter Jugendlichen investiert werden muss. Wenn die Kinder mehr Sport treiben können, ist das gut für ihre körperliche und seelische Gesundheit. Die Jugendlichen haben in Zürich keinen oder wenig Freiraum, wo sie mit FreundInnen hingehen, Sport machen, zusammen sein und sich frei fühlen können. In dieser Stadt gibt es dafür kaum einen Ort. Wenn die Sportinitiative zustande kommt, könnten sie sich zumindest in den Badis und Sportanlagen frei bewegen. Sie könnten zum Beispiel selber einen Fussballklub gründen und auf den Sportanlagen trainieren, ohne eine Aufsicht durch Erwachsene, ohne auferlegte Regeln. Sie könnten etwas alleine schaffen, ohne ständig kontrolliert zu werden. Das, finde ich, ist sehr wichtig für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Denn die Kinder und Jugendlichen werden ständig kontrolliert, zuhause, auf der Strasse, in der Schule. Dieser Punkt ist sehr wichtig für mich: Mehr Freiraum in der Stadt, ohne Kontrolle, ohne Erwachsene.
Die PdA wird im Februar 2018 an den Zürcher Gemeinderatswahlen teilnehmen. Was habt ihr vor?
Wir werden versuchen, in möglichst vielen Wahlkreisen anzutreten, uns dabei aber vor allem auf drei Kreise konzentrieren: Kreis 3, 4/5 und 12. Wenn PdA-GenossInnen und SympathisantInnen Interesse haben, auf unseren Listen anzutreten, sollten sie sich möglichst bald einmal melden. Es fällt auf, dass die Leute an solchen Wahlen nur wenig Interesse haben, besonders die Jüngeren. Das zeigt, dass mit dieser sogenannten direkten Demokratie etwas nicht stimmt. Wir möchten auf dieses Problem aufmerksam machen, deshalb haben wir die partizipative Demokratie zu einem Schwerpunktthema für unseren Wahlkampf gemacht. Je stärker die Leute von der Politik entfremdet sind, desto mehr wird die Politik weiterhin von den Bürgerlichen und den Reichen bestimmt. Wenn die Jugendlichen in der Schweiz eine bessere Zukunft haben wollen, dann muss bei ihnen das Interesse an Politik gestärkt werden. In der gegenwärtigen Situation ist das schwierig zu machen. Auf der Gemeindeebene braucht es deshalb eine andere Organisierung der Politik: Den Quartieren und ihren BewohnerInnen, unabhängig von ihrem Alter oder Pass, muss mehr Entscheidungsmacht gegeben werden. Wir müssen die Demokratie aus dem Privaten, aus der Wohnung ins Quartier herausholen. Ein Problem der Demokratie ist aber auch die Zeit: Die Menschen in der Schweiz haben neben der Arbeit und der Familie kaum Zeit, politisch aktiv zu sein. Die Arbeitszeit muss deshalb in der Stadt bei gleichem Lohn reduziert werden. Für den Anfang könnte dies vielleicht bei den städtischen Angestellten durchgesetzt werden.
Habt ihr weitere Wahlkampfthemen?
In der Stadt Zürich gab es in den letzten 15 Jahren sehr grosse Veränderungen. Die Stadtteile, die vorher vernachlässigt gewesen sind, Kreis 3, 4 und 5, wurden plötzlich in. Es wird dort sehr viel gebaut, es wird viel investiert. Man versucht dadurch, Reiche und UnternehmerInnen anzulocken. Für diese sind Mieten über 5000 Franken im Monat kein Problem. Aber was geschieht mit all den anderen Menschen? Die Leute, die sich solche Mieten nicht leisten können, werden aus diesen Quartieren und aus der Stadt vertrieben. An der Weststrasse haben wir genau das erlebt: Früher lebten dort mehrheitlich Menschen aus Sri Lanka. Die Wohnungen waren in eher schlechtem Zustand. Vor den Häusern gab es viel Verkehr. Mit der Westumfahrung wurde die Weststrasse zu einem beliebten, attraktiven Wohnort, aber die früheren BewohnerInnen sind nicht mehr dort. Es kamen neue BewohnerInnen mit Geld, die prinzipiell wohnen können, wo sie wollen. Gegen solche Prozesse will sich die PdA auch einsetzen. Wir kämpfen für günstigen Wohnraum mittels Genossenschaften und insbesondere städtischen Wohnungen. Heutzutage wird eine Stadt wie Zürich als Fabrik betrachtet, mit der man viel Profit generieren kann. Die Immobilien sind mehrheitlich im Besitz von Versicherungen und Banken und werden von ihnen teuer vermietet, wodurch sie sichere Profite einfahren können. Die Stadt ist aber keine Fabrik! Sie darf nicht wie eine Fabrik funktionieren. Wir müssen genossenschaftlichen und städtischen Wohnungen fördern, damit auch Menschen mit kleinerem Einkommen in Zürich wohnen können.
Aus dem vorwärts vom 28. April 2017 Unterstütze uns mit einem Abo.
 «Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich, ich hab’ noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen», sagte der begnadete Politkabarettist Volker Pispers. Gleiches gilt für Andreas Kunz, Redaktionsleiter der «Sonntagszeitung». In seinem Kommentar in der Ausgabe vom 30. April mit dem Titel «Trallala, der 1. Mai ist da» warnt er fürsorglich seine Leserschaft: «Achtung, morgen ist 1. Mai. Für alle, die nicht in Zürich wohnen: Das ist der Tag, an dem sich die Stadt in einen Kriegsschauplatz verwandelt, vergitterte Polizeifahrzeuge ganze Quartiere abriegeln und Beamte in Hundertschaften und Vollmontur ein linkes Fest vor linken Gewalttätern schützen müssen.» Kriegsschauplatz? Sicher, Tränengas und Gummischrot sind äusserst unangenehm, sie wurden aber nie dafür eingesetzt, das Volksfest auf dem Kasernenareal vor linken GewalttäterInnen zu schützen. Wenn, dann flog das Zeug ins Festareal rein! Tolle Art, das Fest zu beschützen.
«Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich, ich hab’ noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen», sagte der begnadete Politkabarettist Volker Pispers. Gleiches gilt für Andreas Kunz, Redaktionsleiter der «Sonntagszeitung». In seinem Kommentar in der Ausgabe vom 30. April mit dem Titel «Trallala, der 1. Mai ist da» warnt er fürsorglich seine Leserschaft: «Achtung, morgen ist 1. Mai. Für alle, die nicht in Zürich wohnen: Das ist der Tag, an dem sich die Stadt in einen Kriegsschauplatz verwandelt, vergitterte Polizeifahrzeuge ganze Quartiere abriegeln und Beamte in Hundertschaften und Vollmontur ein linkes Fest vor linken Gewalttätern schützen müssen.» Kriegsschauplatz? Sicher, Tränengas und Gummischrot sind äusserst unangenehm, sie wurden aber nie dafür eingesetzt, das Volksfest auf dem Kasernenareal vor linken GewalttäterInnen zu schützen. Wenn, dann flog das Zeug ins Festareal rein! Tolle Art, das Fest zu beschützen.