Der Sozialdemokrat
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=g0vUCggG0UU 331 276]
Georg Schram als Sozialdemokrat und Gewerkschafter.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=g0vUCggG0UU 331 276]
Georg Schram als Sozialdemokrat und Gewerkschafter.

"Foto umverkehR"
In Zürich wurde heute die erste Städte-Initiative mit 7309 Unterschriften eingereicht. «Diese hohe Zahl in Zürich ist ein unmissverständliches Zeichen der Stadtbevölkerung, welche genug von Lärm, Gestank und Staus hat», so Thomas Stahel, Geschäftsleiter von umverkehR. «Die Leute in den Städten und Agglomerationen wollen sich heute mit dem ÖV, Fuss- und Veloverkehr fortbewegen. Die Stadtbehörden sollen sich dementsprechend für klimafreundliche Verkehrsmittel stark machen und einen Ausbau der Strassenkapazität mit allen Mitteln verhindern.»
«Die Städte ersticken immer mehr im Verkehr. Es wundert deshalb nicht, dass alle fünf Städte-Initiative auf grosses Interesse stossen», sagt Nadia Bischof, Kampagnenleiterin bei umverkehR, an der Lancierung. «Die Leute sind heute wieder vermehrt bereit auf ihr Auto zu verzichten. Damit aber diese Leute auch einen Sitzplatz im Tram finden, muss der ÖV ausgebaut werden und die Velowegnetze verbessert. Die Städte-Initiative, welche neben Zürich auch in Basel, Luzern, St. Gallen und Winterthur lanciert worden ist, will den Anteil des ÖV, Fuss- und Veloverkehrs erhöhen. Wie umverkehR mitteilt seien in dicht besiedelten Agglomerationen die Voraussetzungen dazu ideal.
 Der Konflikt um die Schliessung der Zellulosefabrik Borregaard/Atisholz in Luterbach SO verschärft sich. Die Direktion liess am Dienstag die erste Verhandlung mit Vertretern der Gewerkschaft Unia, des Papier- und Kartonarbeitnehmerverbandes (SPV), der Syna und der betrieblichen Arbeitnehmervertretung scheitern. Sie weigerte sich, auf die Forderung nach einer Verlängerung der Konsultationsfrist einzugehen, wie sie vergangene Woche an sehr gut besuchten Betriebsversammlungen von der Belegschaft nahezu einstimmig beschlossen wurde.
Der Konflikt um die Schliessung der Zellulosefabrik Borregaard/Atisholz in Luterbach SO verschärft sich. Die Direktion liess am Dienstag die erste Verhandlung mit Vertretern der Gewerkschaft Unia, des Papier- und Kartonarbeitnehmerverbandes (SPV), der Syna und der betrieblichen Arbeitnehmervertretung scheitern. Sie weigerte sich, auf die Forderung nach einer Verlängerung der Konsultationsfrist einzugehen, wie sie vergangene Woche an sehr gut besuchten Betriebsversammlungen von der Belegschaft nahezu einstimmig beschlossen wurde.
Die Borregaard-Direktion wies nicht nur die Verlängerung der Konsultationsfrist um eins bis zwei Monate kategorisch zurück. Sie weigerte sich zudem, den Gewerkschaften und der Arbeitnehmervertretung Daten zum Betrieb und zur Betriebsschliessung zu liefern. Bis heute erhielten die Gewerkschaften auch keine Auskünfte, wer von den 440 Beschäftigten in welcher Weise von der Betriebsliquidierung betroffen sein wird.
„Das unverantwortliche Verhalten der Direktion zeigt, dass Borregaard den Betrieb in Atisholz möglichst rasch dicht machen und sich Richtung Norwegen aus der sozialen Verantwortung stehlen will“, kritisiert der zuständige Unia-Branchenverantwortliche Corrado Pardini den Verhandlungsabbruch.
Angesichts der Gesprächsverweigerung seien die Gewerkschaften nun gezwungen, eine Gerichtsklage gegen Borregaard zu prüfen. Die Frage müsse geklärt werden, ab wann genau die gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsfrist von 30 Tagen zu laufen beginne: Bei Bekanntgabe des Schliessungsentscheides oder effektiv erst dann, wenn alle relevanten Fakten auf dem Tisch sind.
Zudem wollen die Gewerkschaften und SPV in den nächsten Tagen die Belegschaft eingehend informieren und zum Protest mobilisieren.
 Bei einer Protestaktion unter dem Motto „Das Casino schliessen – die Bahn nicht verzocken!“ haben Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac am Dienstag vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin gefordert, den geplanten Börsengang der Deutschen Bahn zu stoppen.
Bei einer Protestaktion unter dem Motto „Das Casino schliessen – die Bahn nicht verzocken!“ haben Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac am Dienstag vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin gefordert, den geplanten Börsengang der Deutschen Bahn zu stoppen.
“Die Bundesregierung muss jetzt endlich die Notbremse ziehen. Den Börsengang mitten in einer Jahrhundertkrise der Finanzmärkte durchzuziehen, hieße nichts anderes, als die Bahn zu verzocken. Diese gigantische Verschleuderung von öffentlichem Eigentum darf es nicht geben”, sagte Stephan Schilling, Finanzmarktexperte im bundesweiten Attac-Koordinierungskreis. “Nicht genug, dass der Staat mit dem Geld der Steuerzahler Banken retten muss – jetzt will die Bundesregierung auch noch die Bahn in dieses bodenlose Loch werfen.”
Wie in den vergangenen Tagen bekannt wurde, würde der für den 27. Oktober geplante Börsengang der Bahn-Tochter DB Mobility voraussichtlich nur 4,5 Milliarden statt der angepeilten acht Milliarden Euro bringen. Damit nicht genug: Zwei der vier mit dem Börsengang betrauten Konsortialführer, Morgan Stanley und Goldman Sachs, sind wesentliche Akteure der Finanzkrise und nun in Folge ihres unseriösen Geschäftsgebarens selbst in Existenznot geraten. “Spätestens jetzt haben sich diese Banken als Berater der Politik diskreditiert. Ihnen weiterhin das Feld zu überlassen, wäre Wahnsinn”, sagte Stephan Schilling.
Dennoch drängt vor allem Bahn-Chef Hartmut Mehdorn weiter auf den Börsengang, während Bundesfinanzminister Peer Steinbrück erste Zweifel äußerte. “Mehdorn weiß genau, dass die große Mehrheit der Bevölkerung gegen die Bahnprivatisierung ist. Deshalb will er den Börsengang im Hauruck-Verfahren durchziehen, um nur ja keine erneute Diskussion über ihn aufkommen zu lassen”, sagte Chris Methmann, ebenfalls Mitglied im Attac-Koordinierungskreis.
Sollte die Bundesregierung diesem Drängen nachgeben, käme dies nach Ansicht von Attac einem Offenbarungseid gleich. “Noch deutlicher könnte die Bundesregierung nicht machen, dass es bei dem geplanten Verkauf eben nicht – wie von ihr immer behauptet – darum geht, die Bahn mit mehr Kapital auszustatten und den Staatshaushalt zu entlasten, sondern um pure Ideologie: Privatisierung um der Privatisierung willen – koste es die Steuerzahler, die Kunden, die Beschäftigten und die Umwelt, was es wolle”, betonte Chris Methmann. Attac lehnt jede Privatisierung der Bahn ab und setzt sich im Bündnis “Bahn für Alle” für eine verbesserte Bahn in öffentlicher Hand ein. Diese Position teilt die große Mehrheit der Bevölkerung: Bereits bei einer Forsa-Umfrage im Juli 2007 lehnten 64 Prozent der Befragten eine Privatisierung der Bahn ab. Chris Methmann: “Man braucht keine prophetische Gabe, um zu vorauszusagen, dass die Mehrheit gegen einen Bahn-Börsengang in einer aktuellen Umfrage noch deutlich größer ausfallen würde.”
“Bahn für Alle” hat einen Aufruf an die Bundesregierung gestartet, den Bahn-Börsengang auszusetzen. Der Aufruf kann im Internet unterschrieben werden.
Im Internet:
* Attac-Sonderseite “Das Casino schließen!”: www.casino-schliessen.de
* “Bahn für Alle”-Aufruf zur Aussetzung des Börsengangs: http://bahn-fuer-alle.de

Die Gewerkschaft Unia hat heute Vormittag in Bern an einer Medienkonferenz die Bilanz ihrer ersten vier Jahre seit der Fusion 2004 gezogen und einen entsprechenden Tätigkeitsbericht vorgestellt. Mit klaren Worten kritisierte Unia-Co-Präsident Andreas Rieger die Verantwortlichen der Finanzmarktkrise und forderte eine 6-Punkte Sofortprogramm, um die Schweizer Realwirtschaft vor den Auswirkungen zu schützen.
«Die Unia ist gut gestartet und heute aus der Schweiz nicht mehr wegzudenken». Mit diesen Worten eröffnete Unia-Co-Präsident Renzo Ambrosetti die Bilanzpressekonferenz. Die Fusion sei überraschend reibungslos verlaufen und die 200’000 Unia-Mitglieder hätten sich erstaunlich schnell mit der neuen Gewerkschaft identifiziert. Einige Arbeitgebervertreter hätten auf die erfolgreiche Fusion zuerst mit Abwehrreflexen reagiert, doch habe sich die anfängliche Aufregung auf Arbeitgeberseite mit der Zeit gelegt. Seither habe die Unia wichtige neue Gesamtarbeitsverträge – z.B. für Temporärbeschäftigte oder für das Reinigungspersonal – aushandeln können. In der grossen Mehrheit der Fälle habe die Unia am Verhandlungstisch und im Dialog mit den Arbeitgebern Verbesserungen für die Arbeitnehmenden erreicht, so Ambrosetti, «doch wo nötig, war die Unia auch bereit, Arbeitskämpfe zu unterstützen und zu führen.»
Sofortprogramm und nachhaltiger Umbau der Wirtschaft
Als «wichtiges Gegengewicht zu den entfesselten Märkten» bezeichnete Andreas Rieger, ebenfalls Co-Präsident der Unia, die Gewerkschaft. Mit klaren Worten kritisierte er die zerstörerischen Folgen der seit den 90er Jahren grassierenden Deregulierungsideologie, deren Scheitern mit der aktuellen Finanzmarktkrise unübersehbar geworden sei. Statt mit Steuermilliarden die faulen Papiere der Spekulanten aufzukaufen, müssten diese Mittel nun sinnvoll in die Realwirtschaft investiert werden, um diese vor den Auswirkungen der Krise zu schützen. Rieger stellte ein entsprechendes 6-Punkte Sofortprogramm vor, das Zinssenkungen durch die Nationalbank sowie die Kantonal- und Raiffeisenbanken, eine die Konjunktur stimulierende Ausgabenpolitik der öffentlichen Hand, ein Stopp der Preistreiberei der Elektrizitätsbarone, eine Besteuerung der Manager-Topsaläre (über 1 Million Franken) als Unternehmensgewinne und substanzielle Lohnerhöhungen im bevorstehenden Lohnherbst beinhaltet.
Falls die Schweizer Wirtschaft durch die Finanzkrise ernsthaft getroffen werde, müssten zudem bereits beschlossene Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand, insbesondere im Bereich der Infrastruktur und des Transports, beschleunigt umgesetzt werden. «Werden diese Massnahmen nicht ergriffen», so Rieger, «dann macht sich die Politik an einem Abschwung mitschuldig». In jedem Fall aber müsse die Schweiz langfristig in einen ökologisch und sozial nachhaltigen Umbau der Wirtschaft investieren. Dazu gehörten namentlich ein energiepolitisches Sanierungsprogramm des Bundes (Bonus für Gebäudesanierung und Förderung von Spartechnologien) sowie ein Förderprogramm für erneuerbare Energien und entsprechende Technologien.
Erster Unia-Kongress am kommenden Wochenende
Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz stellte Unia-Geschäftsleitungsmitglied Rita Schiavi die Unia als «Mitmach-Gewerkschaft» vor. Die Unia verstehe sich als soziale Bewegung: «Aktive Mitglieder und ein breites Bündnis mit anderen sozialen Bewegungen machen die Kraft und die Ausstrahlung der Unia aus.» André Daguet, ebenfalls Mitglied der Unia-Geschäftsleitung, bezeichnete seine Gewerkschaft als «aktive Kraft in der politischen Landschaft der Schweiz». Sie habe bei zahlreichen Referendums- und Abstimmungskampagnen zu sozialpolitischen Themen und gegen die Deregulierungsoffensive eine wichtige Rolle gespielt. «Die Gründung der Unia hat den gewerkschaftlichen Widerstand gegen die Deregulierung gestärkt.»
Unia-Geschäftsleitungsmitglied Fabienne Blanc-Kühn verwies schliesslich auf die besonders starke Verankerung der Unia in der lateinischen Schweiz, in der fast die Hälfte der Unia-Mitglieder wohnt. Sie lud die Medienvertreter zum bevorstehenden ersten Kongress der Unia in Lugano ein, an dem sich ab Donnerstag nebst mehreren hundert Gästen (darunter Bundespräsident Couchepin) 400 Delegierte treffen, um eine neue Leitung zu wählen und die gewerkschaftspolitischen Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre festzulegen.
 Gewerkschaften in über 100 Ländern, von Fidschi bis nach Alaska, beteiligen sich heute an Aktionen, um zu einem Zeitpunkt, zu dem die Finanzkrise die Existenzgrundlage von Millionen Menschen weltweit bedroht, eine Neuausrichtung der Weltwirtschaft zu fordern.
Gewerkschaften in über 100 Ländern, von Fidschi bis nach Alaska, beteiligen sich heute an Aktionen, um zu einem Zeitpunkt, zu dem die Finanzkrise die Existenzgrundlage von Millionen Menschen weltweit bedroht, eine Neuausrichtung der Weltwirtschaft zu fordern.
„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben genug von einer Politik, die einer kleinen Minderheit durch eine laxe oder nicht existente Regulierung der Finanzmärkte zu enormem Wohlstand verholfen hat, während die Löhne derjenigen, die die Waren oder Dienstleistungen in der realen Wirtschaft tatsächlich produzieren, stagnierten oder zurückgegangen sind. Der Gründungskongress des IGB im Jahr 2006 hat zu diesem weltweiten Aktionstag aufgerufen, um eine grundlegende Umgestaltung der Globalisierung zu fordern und die neoliberale Politik des freien Marktes zu beenden, die uns an den Rand einer katastrophalen weltweiten Rezession getrieben hat. Die Zeit für diese Neuausrichtung ist jetzt gekommen“, erklärte IGB-Generalsekretär Guy Ryder.
Der Tag wird mit einem Treffen jugendlicher Gewerkschafter/innen in Fidschi beginnen, gefolgt von Versammlungen, Demonstrationen, Bildungs-, Kultur- und Medienveranstaltungen in mehr als 500 Städten und Dörfern überall auf der Welt, bevor schließlich ganz im Osten Alaskas die letzte Aktivität zu Ende geht.
Auf der speziell für den Welttag eingerichteten Internetseite (www.wddw.org.) wird live über die verschiedenen Aktivitäten in aller Welt berichtet, mit Videos, Fotos und Berichten. Gewerkschaftsorganisationen aus 115 Ländern haben ihre Aktivitäten anlässlich des 7. Oktober bereits auf dieser Internetseite angegeben, und diese Informationen werden den ganzen Tag über kontinuierlich aktualisiert. Geplant sind u.a. groß angelegte Mobilisierungen in verschiedenen Ländern, einschließlich öffentlicher Kundgebungen und betrieblicher Veranstaltungen, Demonstrationen vor Parlamentsgebäuden, Konzerte, persönliche, telephonische oder E-Mail-Kontakte unter Gewerkschaftsmitgliedern, Seminare unter Beteiligung von Gewerkschaftern, Wissenschaftlern und Politikern sowie groß angelegte Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen und anderswo.
In einer Reihe von Ländern sind von der Gewerkschaftsjugend organisierte Veranstaltungen geplant, und auf allen Kontinenten werden die Gewerkschafterinnen ihre Kampagne „Menschenwürdige Arbeit und ein menschenwürdiges Leben für Frauen“ intensivieren, bei der es um die Hauptanliegen sowohl von Frauen als auch von Männern bei der Arbeit geht, darunter Lohngleichheit und Mutterschaftsrechte. Diese und andere Aktionen auf nationaler Ebene werden mit den drei Hauptthemen des Welttages verknüpft: Rechte bei der Arbeit, Solidarität sowie Armut und Ungleichheit beenden. Bei zahlreichen nationalen Aktionen wird es schwerpunktmäßig um internationale Solidarität mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gehen, die in Ländern wie Birma, Kolumbien, Swasiland und Simbabwe unter schweren Repressionen zu leiden haben.
„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in aller Welt werden bei der ersten Mobilisierung dieser Art gemeinsam ihre Stimme erheben, um gegen die Ergebnisse der mehr als zwei Jahrzehnte währenden Deregulierung zu protestieren: wachsende Unsicherheit, enorme Ungleichheiten und eine Abwärtsspirale im globalen Wettbewerb, bei dem die Profite mehr zählen als die Grundrechte der Menschen. Wir wollen mit diesem Aktionstag wirkliche Veränderungen bewirken“, so Ryder.
Live mitverfolgt werden können die Aktionen zum Welttag für menschenwürdige Arbeit hier: www.wddw.org
Die Videos zum 7. Oktober finden sich hier: http://www.youtube.com/ITUCCSI
 Gestern fand in Bern das Fest zum 1. alljährlichen Anti-SVP-Tag statt. Veranstaltet wurde es vom «Bündnis Schwarzes Schaf».
Gestern fand in Bern das Fest zum 1. alljährlichen Anti-SVP-Tag statt. Veranstaltet wurde es vom «Bündnis Schwarzes Schaf».
«Mit einem kleinen Fest auf dem Bahnhofplatz wollen wir daran erinnern, wie es uns vor einem Jahr gemeinsam gelang, den als SVP-Wahlkampfhöhepunkt geplanten ‹Marsch auf Bern› zu verhindern», schreibt das Bündnis in der Medienmitteilung. Rund 200 Personen haben erneut ein starkes Zeichen gegen die menschenverachtende Politik der SVP gesetzt. Aus diesem Anlass wurde ein Konzert des Rappers Oli Second veranstaltet. «Ausserdem wurde ein antifaschistischer Jahrmarkt aufgestellt» schreiben die VeranstalterInnen, und «so konnte mensch zum Beispiel einem Papp-Nazi auf die Füsse treten oder politische Gefangene befreien.» Viele PassantInnen, besonders durch die SVP-Politik benachteiligte Menschen, reagierten äusserst positiv auf dieses Fest..
Auf dem Flugblatt, der am Anlass verteilt wurde ist unter anderem zu lesen: «Das erlösende Signal hat auch auf andere gewirkt: Blocher wurde abgewählt, die SVP ist mittlerweile nicht mehr im Bundesrat vertreten und viele eher ‹moderate› SVPlerInnen haben der Partei den Rücken gekehrt. Aber damit ist der Kampf noch lange nicht gewonnen. Die Politik der SVP ist populärer denn je. Denn der SVP ist es gelungen einen Rechtsrutsch zu verursachen, der weit über ihren Wählerstimmenzuwachs hinaus geht. Die SVP hat es geschafft, dass mehr oder weniger alle Parteien, sogar die sogenannten SozialdemokratInnen, auf ihren Kurs aufgesprungen sind – und das schon vor dem 6.Oktober 2007!»
Und das «schwarze Schaf» kündigt auch weiterhin den Kampf an: «Trotz Rot-Grün-Mitte Mehrheit: In Bern und in der restlichen Schweiz wurde und wird ‹beste› SVP-Politik betrieben! Nicht etwa die, die einen rassistischen und fremdenfeindlichen Wahlkampf führ(t)en, wurden und werden von schweizer Medien, Politik und Justiz verurteilt, sondern AntifaschistInnen, die sich der SVP in den Weg stell(t)en.In Bern und anderswo gibt es – mit Ausnahme von einigen kleinen Parteien – keine linken Kräfte mehr im Parlament! Aber es gibt sie auf der Strasse! Es ist die Diktatur des Kapitals! Wir werden nicht einfach aufhören und klein bei geben. Wir werden nicht leiser. Wir werden nicht weichen! Aber wir entlarven diese Diktatur! Und darum geht der Kampf weiter: Auf der Strasse, in den Quartieren, in den Fabriken, auf den Baustellen, in den Betrieben!
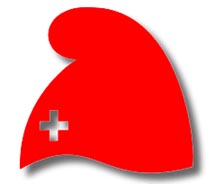 Am 1. und 2. November hält die PdA ihren nationalen Parteitag ab. Zu den wichtigsten statutarischen Traktanden gehört die Behandlung der Anträge der Sektionen. Neben einem Ordnungsantrag betreffend Parteitagspapiere sind eine ganze Reihe Anträge inhaltlicher Art eingereicht worden:
Am 1. und 2. November hält die PdA ihren nationalen Parteitag ab. Zu den wichtigsten statutarischen Traktanden gehört die Behandlung der Anträge der Sektionen. Neben einem Ordnungsantrag betreffend Parteitagspapiere sind eine ganze Reihe Anträge inhaltlicher Art eingereicht worden:
Die Sektion Bern der Partei der Arbeit verlangt in einem ersten Antrag die Klärung der PdA-Haltung in der Frage des EU-Beitritts der Schweiz. Die Sektion Bern vermisst eine einheitliche, fundierte Position der Partei zur Europäischen Union. Dabei macht die Berner Sektion kein Geheimnis aus ihre Ablehnung eines Beitritts der Schweiz zu dieser imperialistischen, neoliberalen und militaristischen Staatengemeinschaft. In der Begründung wird von den Bernern am Beispiel der sogenannten Personenfreizügigkeit gezeigt, wie sehr die EU-Politik im Interesse des Grosskapitals und der kapitalistischen Monopole steht. Den Intentionen der Berner Sektion würde es auch entsprechen, wenn die PdA ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Linkspartei aufgeben würde.
Ein weiterer Berner Antrag verlangt die Umbenennung der Partei der Arbeit der Schweiz in Kommunistische Partei der Schweiz (KPS). Den Sektionen wäre es danach freigestellt, ihren angestammten Namen zu behalten. Sie bezeichnen sich jedoch als «Sektion der KPS».
Die Sektion Zürich verlangt in einem Antrag die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms. Ziel ist es, das neue Programm am Parteitag 2010 zu verabschieden.
Die organisatorische Zukunft der Partei der Arbeit betreffen Anträge der Sektion Waadt und Jura. Die Waadtländer postulieren in einem Resolutionsantrag die Gründung einer neuen Partei im Sinne einer mittel- und langfristigen Vision. Die neue Partei soll nicht einfach ein Zusammenschluss der aktuellen Formationen der «kämpferischen Linken» sein, sondern eine gemeinsame Widerstandsfront einzelner Menschen. Als eine Art Gegenantrag zum Resolutionsentwurf der Waadtländer ist ein Antrag der Sektion Jura zu verstehen, schwebt ihr doch statt einer neuen Partei eine «Föderation der kämpferischen Linken» vor. Die Sektion Jura verlangt von der Parteileitung, entsprechende Gespräche mit andern politischen Gruppierungen aufzunehmen. Die jurassische PdA stellt sich dabei vor, dass alle Gliederungen der Partei in der Föderation durch die PdAS vertreten würden.
Siehe auch:Blog PdA
 Der landesweite Aktionstag, mit dem die drei grössten belgischen Gewerkschaften für mehr Kaufkraft demonstrieren, hat am frühen Montag weite Teil des Landes lahmgelegt.
Der landesweite Aktionstag, mit dem die drei grössten belgischen Gewerkschaften für mehr Kaufkraft demonstrieren, hat am frühen Montag weite Teil des Landes lahmgelegt.
Vor allem die Züge, die bereits seit Sonntagabend 22 Uhr bestreikt wurden, sowie der Nahverkehr in den grossen Städten waren betroffen. Die auf die Eisenbahn angewiesenen Berufspendler waren wohl »mitverantwortlich« dafür, dass bereits gegen 7.45 Uhr 280 Kilometer Stau allein in Flandern gemeldet wurden.
Besonders gut befolgt wurde der Aufruf der Arbeitnehmerorganisationen in Lüttich, wo kein einziger Bus fuhr. Zudem lagen alle grossindustriellen Betriebe still und der Zugang zu den meisten Industriezonen und Geschäftszentren war versperrt. Während der Flugverkehr am Nationalflughafen in Zaventem zunächst normal verlief, waren in Bierset weder Starts noch Landungen möglich.
Seit dem frühen Morgen war auch Verviers durch protestierende Gewerkschaftsmitglieder praktisch von der Aussenwelt abgeschnitten. Auch im Hafen von Antwerpen verhinderten Arbeiter den Beginn der Frühschicht.
Die Gewerkschaften zeigten sich über die Befolgung des Streikaufrufs zufrieden. Arbeitgeberorganisationen haben den Streik als wirtschaftlich schädlich kritisiert.
 Nach den gewaltsamen und zum Teil tödlichen Angriffen auf Ausländer haben in Italien tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Bei einer Kundgebung in der Nähe des Kolosseums in Rom erinnerten am Samstag Hunderte chinesische Demonstranten an einen 36-jährigen Landsmann, der in der italienischen Hauptstadt am Donnerstag von Jugendlichen attackiert worden war.
Nach den gewaltsamen und zum Teil tödlichen Angriffen auf Ausländer haben in Italien tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Bei einer Kundgebung in der Nähe des Kolosseums in Rom erinnerten am Samstag Hunderte chinesische Demonstranten an einen 36-jährigen Landsmann, der in der italienischen Hauptstadt am Donnerstag von Jugendlichen attackiert worden war.
Demonstrationen auch in Caserta
15.000 Menschen auf der Demonstration in Caserta, die übergroße Mehrheit von ihnen Immigranten, sehen sich dagegen als Opfer einer systematisch von oben geschürten fremdenfeindlichen Stimmung im Land. Die Einwanderer erbittert eine Fülle weiterer Übergriffe, in der mal brave Bürger, mal Staatsbeamte sich gehen lassen.
In der letzten Woche wurde in Parma ein 22-jähriger Abendschüler aus Ghana von einem Greiftrupp von Stadtpolizisten in Zivil festgenommen. Die Polizisten glaubten, einen Drogendealer vor sich zu haben. Schon im Wagen, dann im Kommissariat verprügelten sie ihn. Drogen fanden sie nicht. Nach fünf Stunden entließen sie ihn mit einem zugeschwollenen Auge. Dazu erklärten die Beamten, der Junge sei „hingefallen“. Außerdem händigten sie ihm einen Umschlag mit dem Verhörprotokoll aus; obendrauf hatte ein Beamter „Emmanuel Neger“ geschrieben.
Parallel dazu wurde in Rom bekannt, dass Polizisten am Flughafen Ciampino eine 50-jährige Frau aus Somalia mit italienischem Pass stundenlang festgehalten und nackt ausgezogen hatten. Auch sie war als Drogenkurier verdächtigt, auch sie sprach hinterher von üblen rassistischen Beleidigungen.
Die von Berlusconis Rechtsregierung angeheizte „Immigranten-Notstand“-Stimmung im Land findet aber auch willige Nachahmer unter einfachen Bürgern. Ebenfalls in der letzten Woche schlugen Minderjährige einen chinesischen Arbeiter an einer Bushaltestelle nieder. Ehe ein Faustschlag ihm das Nasenbein brach, brüllte der Schläger „Drecks-Chinese“. In Neapels Stadtviertel Pianura kam es zu wütenden Einwohnerprotesten gegen etwa 200 Afrikaner, die seit Jahren dort leben. In Mailand ging ein Marktverkäufer mit einem Baseballschläger auf einen Senegalesen los, weil auch der seine Ware feilbieten wollte.
Erstmals meldete sich mit Gianfranco Fini – dem Frontmann der postfaschistischen Alleanza Nazionale und Präsidenten des Abgeordnetenhauses – ein Politiker der Berlusconi-Koalition zu Wort. Fini hält es für „verfehlt, die Gefahr des Rassismus zu leugnen“. Doch er verlor kein Wort über die Politik der Regierung, die systematisch die „illegalen Immigranten“ zum Sicherheitsproblem Nummer eins erklärt hat und die das Ausländergesetz verschärfen will.
Quellen: Taz.de / Global Project
 Der Umsatz der japanischen Autoindustrie ist im laufenden Jahr auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren gefallen. Das teilte der Händlerverband des Landes mit. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres gab es einen Rückgang von knapp drei Prozent auf 1,54 Millionen Fahrzeuge. So wenig Autos wurden letztmals 1974 verkauft. Besonders Nissan und Toyota leiden. Der Nachfrageeinbruch wird mit der schwachen Konjunktur begründet.
Der Umsatz der japanischen Autoindustrie ist im laufenden Jahr auf den tiefsten Stand seit 34 Jahren gefallen. Das teilte der Händlerverband des Landes mit. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres gab es einen Rückgang von knapp drei Prozent auf 1,54 Millionen Fahrzeuge. So wenig Autos wurden letztmals 1974 verkauft. Besonders Nissan und Toyota leiden. Der Nachfrageeinbruch wird mit der schwachen Konjunktur begründet.
«Der japanische Autobauer Nissan rechnet angesichts der Finanzkrise für 2008 und 2009 mit einer weiter sinkenden Nachfrage in Europa», meldet handelsblatt.com. Eine Folge «schmaler Portemonnaies» bei den Kunden werde sein, dass noch mehr kleine Autos verkauft werden. Das Fazit der Zeitung, dass auf bevorstehende «Umstrukturierungen» hinweist: «Den Herstellern stünden deshalb weitere Kostensenkungen ins Haus.»
 Über die Einführung von biometrischen Pässen kommt es wahrscheinlich zu einer Volksabstimmung. Das überparteiliche Komitee von Gegnern hat gestern in Bern 55’000 Unterschriften für ein Referendum dagegen eingereicht.
Über die Einführung von biometrischen Pässen kommt es wahrscheinlich zu einer Volksabstimmung. Das überparteiliche Komitee von Gegnern hat gestern in Bern 55’000 Unterschriften für ein Referendum dagegen eingereicht.
Die Unterschriftenkartons wurden um 17.30 Uhr bei der Bundeskanzlei in Bern überreicht. Um 18 Uhr lief die Frist für die Einreichung ab.
Robert Devenoges, der Sprecher des „Überparteilichen Komitees gegen biometrische Schweizer Pässe und Identitätskarten“, hatte zuvor auf Anfrage keine genaue Zahl angeben können. „Wir wurden in den vergangenen Stunden so überrannt, dass wir die Unterschriften selber gar nicht mehr aufnehmen konnten.“
Die Übergabe der Unterschriften bedeutet zwar nicht, dass das Referendum unter Dach und Fach ist. Damit das Referendum zu Stande kommt, muss die Kanzlei die Unterschriften zuerst prüfen und das Erreichen von 50’000 gültigen Unterschriften bestätigen. Ein allfälliger Abstimmungstermin ist noch offen. Das erste mögliche Datum ist nach Angaben der Bundeskanzlei der 17. Mai 2009.
 Die Angestellten der Zellulosefabrik Atisholz in Luterbach SO wollen die vom norwegischen Borregaard/Orkla-Konzern angekündigte Schliessung nicht kampflos hinnehmen. An einer sehr gut besuchten Betriebsversammlung beschlossen sie am Donnerstagvormittag nahezu einstimmig, zusammen mit den Gewerkschaften Unia und SPV gegen das rücksichtslose «Todesurteil» und für die Erhaltung der 440 Arbeits- und Ausbildungsplätze zu kämpfen.
Die Angestellten der Zellulosefabrik Atisholz in Luterbach SO wollen die vom norwegischen Borregaard/Orkla-Konzern angekündigte Schliessung nicht kampflos hinnehmen. An einer sehr gut besuchten Betriebsversammlung beschlossen sie am Donnerstagvormittag nahezu einstimmig, zusammen mit den Gewerkschaften Unia und SPV gegen das rücksichtslose «Todesurteil» und für die Erhaltung der 440 Arbeits- und Ausbildungsplätze zu kämpfen.
Die Mitarbeitenden fordern den Rückzug des Schliessungsentscheids, die Verlängerung der Konsultationsfrist bis 31. Januar 2009 und die sofortige Aufnahme von Sozialplan-Verhandlungen. Die Unia präsentierte an der Versammlung bereits erste Projekte eines Rettungsplans für die Erhaltung der 440 Arbeits- und Ausbildungsplätze.
«Wir lassen uns nicht mit einer menschenverachtenden Politik der fertigen Tatsachen abspeisen», rief der Unia-Branchenverantwortliche Corrado Pardini die Belegschaft zum Widerstand auf. Pardinis Forderung: «Borregaard muss unverzüglich an den Verhandlungstisch sitzen und alle Unterlagen offenlegen, die für die Erarbeitung und Prüfung alternativer Lösungen erforderlich sind.» Dabei wird die Unia auch vom Schweizerischen Papier- und Kartonarbeitnehmerverband (SPV) unterstützt.
Pardini verwies an der Betriebsversammlung zudem auf zwei konkrete Alternativ-Projekte («Hefe Süd» und «Austria»), welche von Kadermitarbeitern der Borregaard entwickelt und vorangetrieben werden. Mit diesen Projekten könnten nahezu die Hälfte der bedrohten Arbeitsplätze gerettet werden. Diese Pläne verdienen eine echte Chance und dürfen nicht durch eine überstürzte Schliessung zunichte gemacht werden.
Die Borregaard-Belegschaft in Luterbach verlangt daher eine Verlängerung der Konsultationsfrist bis Ende Januar 2009. Zudem müssten die Borregard-Mitarbeitenden mit einer Durchhalteprämie im Betrieb gehalten werden. Gefordert werden Lohnzuschläge von 50 % ab Oktober, 100 % ab Dezember und 150 % ab Januar. Mit Blick auf die fälligen Sozialplanverhandlungen verlangt die Belegschaft zudem die Offenlegung der Zahlen der Wohlfahrtstiftung. «Die Gelder, mit denen uns die Direktion billig abspeisen will, gehören sowieso uns» heisst es in der Entschliessung der aufgebrachten Belegschaft.
 Gemäss grundrechte.ch vorliegenden Angaben sind während der EURO 08 nicht – wie die Verantwortlichen in ersten Bilanzen behauptet haben – 550 sondern 1000 Personen festgenommen oder verhaftet worden.
Gemäss grundrechte.ch vorliegenden Angaben sind während der EURO 08 nicht – wie die Verantwortlichen in ersten Bilanzen behauptet haben – 550 sondern 1000 Personen festgenommen oder verhaftet worden.
Diese und zahlreiche weitere Informationen sind in der Auswertung des Beobachtungs- und Rechercheprojekts, das grundrechte.ch anlässlich der Euro lanciert hatte enthalten. Die fundierte Bilanz der Einschränkung von Grundrechten während der EURO 08 erscheint als Beilage der WOZ-Ausgabe vom 2. Oktober.
Ein offensichtliches Fazit aus Grundrechte-Sicht ist, dass die Polizei und die Sicherheitsdienste gegenüber ausgelassenen ausländischen EURO-Fussballfans eine wesentlich grössere Toleranz zeigten als gegenüber „einheimischen“ BesucherInnen oder anlässlich von Kundgebungen und schweizerischen Club-Fussballspielen. Die zahlreichen, bei grundrechte.ch und anderen Basisgruppen eingegangenen Erlebnisberichte zeigen die Zwiespältigkeit polizeilicher Gastfreundschaft eindrücklich auf. In diesem Zusammenhang setzt grundrechte.ch ein grosses Fragezeichen hinter die von diversen Polizeien nun geltend gemachten Überstunden.
grundrechte.ch fordert nun die Verantwortlichen in der Politik auf, genau zu prüfen, in wie weit Teile dieser Überstunden nicht hausgemacht sind – zum Beispiel anlässlich der unverhältnismässigen Polizeiaktionen im Vorfeld der EURO 08, die von der Polizei selbst als Euro-Testaktionen bezeichnet wurden (Grosseinsätze und flächendeckende Festnahmen von unbeteiligten oder friedlich demonstrierenden Personen in Basel, Bern, Luzern etc.) oder durch unnötige Personenkontrollen abseits jeglicher Euro-Fanmeilen.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=p20RkWK1vtA 331 276]
 Mit einer symbolischen Blockade der Frankfurter Börse unter dem Motto „Das Casino schliessen!“ haben Aktivistinnen und Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac und seiner Jugendorganisation Noya für eine echte Regulierung der Finanzmärkte demonstriert und einen entsprechenden Forderungskatalog von Attac vorgestellt.
Mit einer symbolischen Blockade der Frankfurter Börse unter dem Motto „Das Casino schliessen!“ haben Aktivistinnen und Aktivisten des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac und seiner Jugendorganisation Noya für eine echte Regulierung der Finanzmärkte demonstriert und einen entsprechenden Forderungskatalog von Attac vorgestellt.
„Wenn Merkel und Steinbrück uns jetzt glauben machen wollen, diese Jahrhundertkrise sei eine rein amerikanische Krise, dann ist das lächerlich. Die Krise hat ihren Ursprung in der neoliberalen Deregulierung der Finanzmärkte. Und die wurde in Deutschland genauso betrieben wie in den USA“, sagte Stephan Schilling, Finanzmarktexperte im Attac-Koordinierungskreis. In den USA müssten nun die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hunderte Milliarden Dollar aufbringen, um den Zockern an der Wall Street aus der Misere zu helfen. Doch damit nicht genug: Die Finanzmarktkrise drohe die Weltwirtschaft mit sich nach unten zu reißen, der zu erwartende massive Einbruch der Realwirtschaft könne hunderttausende Arbeitsplätze kosten. „Die Banken haben mit ihrer Zockerei den Zusammenbruch des gesamten ökonomischen Systems riskiert – aktiv befördert von einer Politik der systematischen Deregulierung. Damit muss Schluss sein. Es ist Zeit, das Casino zu schließen“, stellte Stephan Schilling klar.
Attac forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück auf, sich endlich wirksam für verschärfte Finanzmarktgesetze einzusetzen. Zwar rede auch Merkel auf einmal von Regulierung, dahinter verberge sich aber der altbekannte wachsweiche Appell nach mehr Transparenz und Selbstdisziplin der Finanzakteure. So betonte die Kanzlerin am Montag beim Unternehmertag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, es müsse „nicht immer gleich ein neues Gesetz geben“, sofern die Wirtschaft bereit sei, „bestimmte Regeln für sich selbst zu akzeptieren“. Dazu Attac-Finanzmarktexperte Detlev von Larcher: „Das ist ein schlechter Witz. Wer jetzt noch auf freiwillige Selbstverpflichtungen derjenigen setzt, die uns das Desaster eingebrockt haben, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Was wir jetzt brauchen, ist neues Finanzsystem. Die Vorschläge dafür liegen längst auf dem Tisch.“
In dem vorgelegten Massnahmenkatalog fordert Attac
Zeitgleich zu der Blockade der Frankfurter Börse demonstrierten Mitglieder des europäischen Attac Youth Network auch vor den Börsen in Paris, Helsinki, London und Oslo.
Bürgerinnen und Bürger, die den Attac-Forderungskatalog unterstützen möchten, können sich an einer E-Mail-Aktion beteiligen http://www.casino-schliessen.de/aktuell/casino-schliessen/deine-stimme/
Die CSU ist zum 16. Landesverband der CDU geworden. Ein Jahr nach ihrer Gründung hat DIE LINKE einen engagierten Wahlkampf geführt aber leider den Einzug in den Bayerischen Landtag nicht geschafft. Fragen an Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer der LINKEN.
Das erste Wahlkampfziel – 50 Prozent minus x für die CSU – hat die LINKE erreicht. Das zweite – den Einzug in den Landtag – offenbar nicht. Gemischte Gefühle?
Auch wenn wir leider höchstwahrscheinlich nicht in den bayerischen Landtag einziehen können, war gestern für uns dennoch ein guter Tag. Wir haben den Trend des Zuwachses erhalten. Zur Bundestagswahl 2005 erreichte die LINKE in Bayern 3,4 Prozent, jetzt liegen wir deutlich über vier Prozent. Für Große Koalition und CSU ist das Ergebnis ein Desaster. Die CSU ist zum 16. CDU-Landesverband geworden. Wir sind Zeuge vom Ende der letzten Staatspartei.
Welche Folgerungen sehen Sie für die Große Koalition?
Ein weiteres Mal nach Hessen, Niedersachsen und Hamburg haben beide Parteien verloren – in Bayern fast 20 Prozent. Ich habe die große Sorge, dass die Große Koalition nun gar nicht mehr handelt. Im Prinzip ist gestern das Ende der Großen Koalition eingeläutet worden. Der Schwielowsee hatte für die SPD keinen Effekt, weil den Wählern das Auswechseln von Köpfen nicht reicht – die Politik muss verändert werden.
Bayern ist für die LINKE nach wie vor schwieriges Terrain oder?
Wir hatten es im Wahlkampf nicht leicht und haben trotz des ausgerufenen Kreuzzuges zulegen können. Fest steht: Die Bayern haben entschieden, dass sie als Letzte eine Linksfraktion bekommen. Sie sehen die linke Erfolgsserie im Westen nicht unterbrochen? Nein – auch wenn wir unser Ziel, in den Landtag einzuziehen, nicht geschafft haben.
Fragen: Gabriele Oertel, Neues Deutschland
 von Von Werner Pirker
von Von Werner Pirker
Fast ein Drittel der österreichischen Wählerinnen und Wähler hat für die beiden Parteien der extremen Rechten gestimmt. Die Mischung aus nationaler und sozialer Demagogie hat ihre Wirkung nicht verfehlt. In erster Linie aber war es die Politik der Regierungskoalition aus SPÖ und ÖVP, die den Wählerstrom zur chauvinistischen Rechten lenkte. Vor zwei Jahren, als das Wahlergebnis den deutlich artikulierten Wunsch nach einer sozialen Wende zum Ausdruck brachte, hatten die rechten Stimmungsmacher nicht viel mitzureden. Haiders BZÖ fristete außerhalb Kärntens ein jämmerliches Sektendasein, und die Strache-FPÖ deutete mit elf Prozent zwar ihre Gefährlichkeit an, Erinnerungen an Haiders beste Zeiten aber vermochte auch sie nicht auszulösen.
Doch dann kamen die zwei Jahre der großen Koalition, zwei Jahre des sozialen Stillstands und enttäuschter Hoffnungen. Die SPÖ opferte ihre wichtigsten Wahlversprechen dem Koalitionsfrieden, und die ÖVP tat, als wäre sie nicht abgewählt worden. Daß sich die Sozis von den Schwarzen vorführen ließen, war nicht allein sozialdemokratischer Charakterschwäche zuzuschreiben, sondern vor allem dem Umstand, daß an einen wirklichen Bruch mit der neoliberalen Gegenreform nie gedacht war. Erst nach der Aufkündigung der Koalition durch die ÖVP vermochte die SPÖ unter ihrem neuen Spitzenkandidaten Werner Faymann die Regierungsinitiative zu erobern. Das brachte ihr immerhin noch den ersten Platz an den Wahlurnen ein.
Nur schwer nachvollziehbar ist freilich der Wiederaufstieg der Haider-Partei, die nach ihrer blamablen Darbietung in der Regierung Schüssel auf Bundesebene eigentlich schon erledigt schien. Die von neoliberaler Regierungstätigkeit unbelastete FPÖ Straches hingegen ließ immerhin ein Gefühl für die sozialen Befindlichkeiten der Menschen erkennen. Und sie hat auch von allen Parlamentsparteien am deutlichsten Position gegen die EU und dem ihr innewohnenden Demokratieabbau Stellung bezogen. Doch ist die FPÖ vor allem auch eine Partei, die – gegenwärtig mit einer Antiislam-Kampagne – eine hemmungslose Rassisierung der sozialen Frage betreibt.
Der rechte Vormarsch wirft die Frage nach dem Zustand der österreichischen Linken auf. Das erfolgreiche kommunistische Projekt in der Steiermark vermochte nicht zu expandieren, weil die Bundes-KPÖ eine abstrakte linke Agenda verfolgt und jeglicher sozialen Kompetenz verlustig gegangen ist. Und der Linksradikalismus ist nur die radikale Übertreibung dieses Zustandes.
Quelle: junge Welt