Es lebe der 8. März!
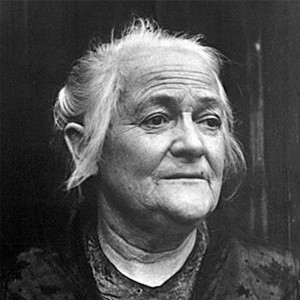 Bei dem Streik der Textilarbeiterinnen am 8. März 1857 in New York, den sie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen organisierten, wurden 129 Frauen ermordet. Auf der zweiten Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen im Jahre 1910 schlug Clara Zetkin vor, dass ein Tag im Jahr als internationaler Einheits-, Kampf- und Solidaritätstag der Frauen eingeführt werden solle. Festgelegt wurde der 8. März dann zu Ehren des Kampfes der New Yorker Textil-arbeiterinnen.
Bei dem Streik der Textilarbeiterinnen am 8. März 1857 in New York, den sie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen organisierten, wurden 129 Frauen ermordet. Auf der zweiten Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen im Jahre 1910 schlug Clara Zetkin vor, dass ein Tag im Jahr als internationaler Einheits-, Kampf- und Solidaritätstag der Frauen eingeführt werden solle. Festgelegt wurde der 8. März dann zu Ehren des Kampfes der New Yorker Textil-arbeiterinnen.
Am 8. März 1917 hoben die Arbeiterinnen von St. Petersburg die Fahne des Kampfes in die Höhe. Dieser Streik war der Beginn der Oktoberrevolution und richtete sich gegen den Zarismus und die Armut. Der 8. März ist auch zu ihren Ehren der internationale Kampf- und Solidaritätstag der Frauen. Somit entwickelte sich der 8. März zu einem Tag, den internationale Arbeiterinnen mit ihrem Leben bezahlten, an dem der Gleichheits- und Befreiungskampf gemeinsam gefeiert wird und an dem die aktuellen Forderungen der Frauen formuliert werden.
Seit dem ersten organisierten Streik der Frauen am 8. März 1857 sind 159 Jahre vergangenen. In diesen 155 Jahren haben Frauen einige Rechte gewonnen und einen langen Weg zurückgelegt. Doch die Profitgier der Kapitalherrscher, die eine tödliche Kriegspolitik betreiben, die zu Krisen führt, die Arbeitslosigkeit produziert und die Armut wie eine Lawine wachsen lässt, führt auch Stück für Stück zu der Rücknahme der ArbeiterInnenrechte, die jahrelang erkämpft wurden.
Die Frauen, die die Sklaven der Sklaven sind, werden nur aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind, dies wissend geprägt und so gebildet. Ebenso wird zu Gewalt gegriffen, um ihnen gewisse Verhaltensweisen zu lehren. Sie werden zweifach unterdrückt und im Namen der Ehre ermordet. Ihre Sexualität wird vermarktet, wird gekauft und verkauft. Sie werden vergewaltigt und sexuell belästigt. In Kriegen sind sie die zu erobernden Schätze. Obwohl die Frau jeden Tag aufs Neue diejenige ist, die das Leben reproduziert, hat sie in keinem Bereich des Lebens ein Mitspracherecht, nicht einmal über ihren eigenen Körper und ihr Leben. Frauen sind diejenigen, die als billige Ersatzarbeitskraft eingestellt werden, und in Krisenzeiten als erste entlassen werden. Wenn innerhalb der Familie die Arbeitslosigkeit steigt, wird die gesellschaftliche Rolle der Frau immer wichtiger. Denn trotz der Armut ist es weiterhin die Aufgabe der Frau, die Familienmitglieder satt zu machen und glücklich zu stimmen. Sobald Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit keine Rechte mehr sind, sondern privatisiert und als Ware verkauft werden, sind auch hier die Frauen die ersten, die diese Rechte verlieren. Doch damit nicht genug! Auch übernehmen Frauen – als sei es ein ungeschriebenes Gesetz – die Pflege von Hilfsbedürftigen. Arbeitslosigkeit und Armut führen dazu, dass Frauen weltweit zur Zielgruppe des Sexsektors werden; dass die psychischen Probleme innerhalb der Gesellschaft und die häusliche Gewalt zunehmen; und dass Frauenmorde und Gewalt an Frauen in grausamer Art und Weise steigen.
Ruhm denjenigen, die den 8. März erschaffen haben und heute am Leben halten!
Die Zahlen der Streikenden auf Strassen, in Fabriken und Schulen weltweit gegen diese Ungerechtigkeiten, die Ausbeutung und Grausamkeit nehmen zu und Frauen scheuen sich nicht, ihren Platz an den Fronten einzunehmen. Die Fackel, die 1857 durch die streikenden Frauen entflammte, lodert heute in den Händen der Arbeiterinnen.
Arbeiterinnen, liebe Frauen, liebe Freunde, lasst uns gemeinsam gegen dieses Leben als Sklaven, das uns aufgezwungen wird, auf die Strassen gehen! Lasst uns gemeinsam gegen den Sozialabbau, die Arbeitslosigkeit, Armut und sexistische Gesetze kämpfen! Lasst uns am 8. März solidarisch unsere gemeinsamen Parolen rufen!
Es lebe der internationale Kampftag der Frauen!
Auf der sozialistischen Frauenkonferenz im August 1910 wurde beschlossen, «als einheitliche internationale Aktion einen alljährlichen Frauentag», einen gemeinsamen Kampftag der Arbeiterinnenbewegung zu begehen. Unter dem Kampfruf «Heraus mit dem Frauenwahlrecht» gingen am ersten internationalen Frauentag, am 19. März 1911, alleine in Deutschland mehr als eine Million Frauen auf die Strasse und forderten für alle Frauen soziale und politische Gleichberechtigung. Auch heute sind diese Forderungen aktuell: Weltweit leben Frauen in patriarchalen Herrschaftsverhältnissen und sind mit Unterdrückung und Ausbeutung konfrontiert. Mehrheitlich Frauen und Mädchen werden Opfer von Armut und Gewalt, wobei laut WHO-Statistik 2001 global Gewalt die Haupttodesursache für Frauen ist, noch vor Krebs, HIV und Herzinfarkt. In Deutschland verdienen sie im Falle von geregelten Arbeitsverhältnissen durchschnittlich 23 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen und sind überproportional häufig im Niedriglohnsektor beschäftigt. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist eine gesellschaftlich akzeptierte Tatsache, die in patriarchalen und heteronormativen Systemen zu dessen Aufrechterhaltung immer weiter reproduziert wird. Deshalb ist die Frage der Geschlechterverhältnisse nicht losgelöst von der grundsätzlichen hierarchischen Beschaffenheit der Gesellschaft zu denken, die nach ausgrenzenden Kategorien wie Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnie, Nationalität, Behinderung, Klasse und anderen funktioniert.
Für eine Welt ohne Patriarchat, Ausbeutung und Unterdrückung
Und trotz allem bleibt es noch ein weiter Weg, bis die Gleichheit in allen Bereichen und Augenblicken des Alltags Realität wird. Es gibt noch zahlreiche Situationen, in denen sich die Diskriminierung der Frau fortsetzt, in der sie ungleich behandelt wird, Respekt und Gerechtigkeit fehlen. Es reicht ein Blick hin zu unseren Nachbarinnen, zu den Familien in unserem Wohnviertel, zu unseren Arbeitskolleginnen, zu den arbeitenden Frauen auf anderen Kontinenten um festzustellen, dass noch immer Unterschiede, Diskriminierung und Gewalt auf Grund des Geschlechtes existieren. Wir beobachten, dass sich diese Situation heute, wegen der aktuellen globalen Krise verschärft hat. Ohne Erbarmen trifft sie die Arbeiterklasse, aber auf eine viel brutalere Weise und sehr viel härter die am leichtesten zu verletzenden und benachteiligten Gruppen, wie , neben anderen, die Frauen , insbesondere die armen und jungen Frauen, so wie die Migrantinnen.
Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der die kapitalistische Ordnung überwunden ist und nicht der Profit im Mittelpunkt steht. Für eine Welt, in der Patriarchat, Ausbeutung und Unterdrückung keinen Platz haben.
Aus dem vorwärts vom 4. März 2016 Unterstütze uns mit einem Abo!
















