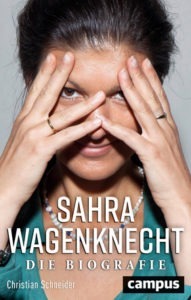Tommy Vercetti by Moritz Keller
flo. Tommy Vercetti ist Rapper aus Bern. In seinen Texten geht es um die grossen Themen Liebe, Hoffnung, Kindheit, Macht, Kapitalismus. Mit Sozialkritik steckt er nicht zurück. Vor kurzem stürmte er mit seinem neuen Album «No 3 Nächt bis morn» die Spitze der Schweizer Albumcharts. Ein Gespräch über Brecht, Kommunismus und über die Verantwortung von Künstler*innen bei der Errichtung einer anderen Welt.
Es ist 2019, die Klimastreiks bringen die Jugend auf die Strasse, der Frauen*streik hat über die Generationen hinweg mobilisiert. Die Grünen überholen in Umfragen die CVP und Tommy Vercetti, ein Rapper und Kommunist aus Bern, setzt sich an die Spitze der Albumcharts. Was ist da los?
Also ich mache jetzt eine nüchterne Einschätzung und mit nüchtern meine ich eine, die nicht pessimistisch sein will noch Self-Fulfilling-Optimismus, wo ich sage, es kommt alles toll, weil ich will, dass es toll kommt. Ich würde sagen, dass im Moment gewisse Widersprüche auf gewisse Krisenphänomene viel offenbarer werden. Diese Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren einen sehr liberalen Anstrich gegeben, was bei den Frauen* beispielsweise zu gewissen Widersprüchen führte, weil sie eben merkten: Unsere Rechte wären so, unsere tatsächliche Situation sieht aber ganz anders aus. Und das ist der Aspekt davon, weswegen solche Bewegungen aufkommen. Vielleicht profitiert das Album ja von diesen Entwicklungen. Die leicht kritischere Frage, die hier aufkommt, ist: Inwiefern bringt der Spätkapitalismus so einen Raum hervor, der eine Art psychologisch reinigende Wirkung hat, wo die Gesellschaft sich mit ihren Problemen quasi unproblematisch auseinander setzen kann.
Ich fall jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Wie hältst du es eigentlich mit der Revolution?
(lacht) Ich glaube schon, dass Revolution der einzige Weg ist, die Welt in einem notwendigen und vernünftigen Mass zu verändern. Dann kommt aber die zweite Frage: Was genau verstehen wir unter Revolution? Neuestens ist ja der Begriff der «Transformation» aufgekommen. Der bietet eine Chance, aber auch ein Risiko und das Risiko ist, dass es ein Problemverdeckerbegriff ist. Denn er suggeriert, dass man die Frage von Reform oder Revolution nicht mehr lösen muss, denn in Begriff Transformation wären ja beide irgendwie enthalten. Ich glaube dass eine Revolution nötig ist und ich glaube, dass sie möglich ist, weil Herrschaftsverhältnisse immer etwas extrem fragiles waren und weil Herrschaftsverhältnisse etwas sind, das von der Akzeptanz der Beherrschten abhängt. Macht ist etwas zirkuläres. Das bedeutet: Ich bin der König – aber nur solange du akzeptierst, dass ich der König bin. Wenn die Beherrschten die Beherrscher nicht mehr anerkennen, bricht das zusammen.
Ein Marxist also?
Es ist ja immer schwierig, wer was unter was versteht. Es gibt schon viele Sachen, die ich anders sehe, die man auch zu Marx‘ Zeiten nicht vorhersehen konnte oder die sich geändert haben. Aber doch, ich würde mich schon als Marxist bezeichnen.
Davon, wie der Kapitalismus funktioniert, rappst du auch auf deinem neuen Album. Dein letztes Album, für das du den Berner Literaturpreis erhalten hast, hatte ja auch schon ziemlich klare politische Schlagseite. «No 3 Nächt bis morn» scheint aber eine neue Qualität zu erreichen. Zufall?
Das Album ist auf eine Weise schon politischer geworden. Ich würde behaupten, dass ich mit «Seiltänzer» schon grosse Themen angesprochen habe, Kindheit, Religion Tod, die zwar auch aktuelle Themen sind, die mit dem Kapitalismus zu tun haben aber vielleicht doch ein bisschen universeller sind: Sie beschäftigen wohl ebenso ein Amazonasvolk. Dieses Mal habe ich versucht mir die Frage zu stellen: Was sind die grossen Themen. Aber vor allem: was sind die grossen Themen heute, hier.
Und woher kommt das alles? Sich linkspolitisch zu positionieren ist in der Schweiz ja nicht unbedingt immer populär. Wieso dieser pointierte Einsatz, obwohl es ohne wohl einfacher wäre?
Was ich schon an mir loben würde, ist, dass ich ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden habe, und damit kommt vielleicht auch eine gewisse Integri-tät einher. Ich denke, niemand würde mich als «Egoist» beschreiben. Aber da kommt ganz klar dazu, dass ich selber, meine Familie, Leute die mir sehr nahe stehen, Leidtragende dieses Systems sind. Ich bin quasi direkt betroffen. Klar geniesse ich aktuell einen gewissen Komfort. Es geht mir nicht schlecht. Aber ich werde nie etwas erben, meine Stabilität ist also auch eine fragile, man kann ebenso schnell absteigen, wie man aufgestiegen ist. Meine Freundin ist Tochter einer Flüchtlingsfamilie, meine Grossmutter war italienische Migrantin, die drei Jobs hatte und die Kinder allein aufzog. Mein ganzes Umfeld ist irgendwie geprägt durch diese Erfahrungen. Es ist also einerseits eine Art persönliche Motivation. Und dann durch die Beschäftigung damit – wer sich ernsthaft und genuin mit solchen Sachen auseinandersetzt, kann nur radikaler werden. Ich sehe nicht, wie man bei der Beschäftigung mit diesen Themen ökonomisch liberaler oder mittiger werden kann. Neben diesen persönlichen und emotionalen Beweggründen wäre mir noch nie intellektuell und argumentativ etwas begegnet, das mich von diesem Weg abgebracht hätte. Ich hatte aber auch das Glück, dass mir das noch nie zum Hindernis wurde. Ich finde auch, dass man ganz klar aussprechen muss: Ich bin Kommunist. Und man muss auch versuchen die Begriffe zu rehabilitieren und in die Offensive zu gehen. Wir leben aber auch in einer Zeit, in der das auch auf unnötige Antipathie stösst. In Interviews spreche ich das selten direkt an. Wenn ich aber sage: «Privateigentum ist ein Problem, weil dann so viele Leute über uns bestimmen können. Das betrifft mein Leben, das betrifft dein Leben», dann verstehen die Leute das. Wenn du aber für die Abschaffung des Privateigentums bist, bist du irgendwie immer auch Kommunist*in oder Anarchist*in und dann sieht’s plötzlich anders aus.
Du hattest vorher Kindheit, Liebe, Tod und so weiter als Themen deiner Musik erwähnt. In deinem neuen Album spielt ja auch Hoffnung eine grosse Rolle. Was also ist die Sicht auf deine Rolle als Künstler in diesem Kampf für eine andere Welt?
Ja das ist natürlich die grosse Frage und es ist eine Frage, die mich schon sehr lange umtreibt. Als ich, damals noch für das Album «Seiltänzer» das Lied «Zitadella» schrieb, stiess ich das ganze Thema schon einmal an. Ich finde, Kunst darf nicht in den Dienst der Politik treten. Ich denke, Kunst ist wirklich dann am politischsten, wenn sie autonom ist. Mir ist völlig klar, dass die Autonomie der Kunst historisch gewachsen und eine neuere Erscheinung ist. Oder dass sie vielfach auch illusionär ist. Aber da gibt es kein Zurück mehr. Und ich glaube, hier ist Kunst auch am einflussreichsten und glaubwürdigsten. Die Frage, wie ich am meisten bewegen kann, hat mich lange beschäftigt und ich bin zum Schluss gekommen: Am meisten kann ich wirklich machen, wenn ich einfach versuche, möglichst gute Musik zu machen und meine politischen Gedanken darüber kommuniziere. Und dort glaube ich, dass Kunst am politischsten ist, wenn sie ästhetisch versucht radikal zu sein, wenn sie versucht genuin zu sein. Kunst hat ein unglaubliches Potenzial den Denkrahmen aufzusprengen. Wir leben in einer ideologisch extrem verengten Zeit. «Verengt» bedeutet, dass die Leute sich nichts mehr anderes vorstellen können als Kapitalismus und Markt. Wenn du heute sagst, du hast ein Problem mit Kapitalismus, mit Marktwirtschaft, heisst’s gleich «jo was de süsch?!» Weil man sich nichts anderes mehr vorstellen kann. Und da setzt die Aufgabe der Kunst an, weil man dort eben nicht alles perfekt mit Studien belegt und durchargumentiert sein muss, um neue Vorstellungen zu präsentieren. Kunst hat diese Sachzwänge nicht. Wenn ich ein Lied mache über eine Insel, auf der der Wohlstand anders verteilt wird, muss das Ziel sein, dass das in den Köpfen etwas macht und man sich sagt «es ginge schon anders».
Damit wir den Kreis dialektisch schliessen können: Wir haben darüber gesprochen welchen Einfluss Künstler*innen auf die Bewegung, auf den Kampf für eine andere Welt haben, jetzt anders herum gefragt: Welchen Einfluss haben die Bewegungen auf die Kunst?
Ich glaube, das hängt erst einmal stark davon ab, wie sehr die Kunst integriert ist, wie fest sie sich mit der Bewegung identifiziert. Und das ist auch etwas, worüber ich gesagt habe, dass es nicht gekoppelt sein dürfe, nicht im Dienst davon stehen dürfe. Der Künstler nimmt da irgendwie eine dritte Instanz ein, wo er auch die Bewegung, die Politik kritisieren kann. Die Frage, wie nah der Künstler der Bewegung ist, ist ganz zentral und ich bin eben nahe der Bewegung, ich bewege mich im linken Diskurs, ich sehe mich als – nicht sehr aktiver, aber doch – Teil der Bewegung. Und ich denke das sieht man auch am Album. Ich finde es sollte zumindest jeden Künstler*in irgendwie interessieren, was politisch geschieht. Er muss sich nicht explizit politisch äussern, aber ich finde wichtig, dass ein Künstler spürt, was abgeht. Also eine Art Sensibilität für die Zeit besitzt. Jetzt kommt aber schon die nächste Frage: was «politisch» denn genau meint. Ich würde sagen, Kafka beispielsweise war schon jemand, der nicht stark von den politischen Bewegungen beeinflusst war, dennoch einer, der mit seinem Gespür etwas unglaublich Politisches schuf.
In «Güetzi» portraitierst du den Kapitalismus nur dünn maskiert mithilfe von tyrannischen Kindern, die auf dem Spielplatz über alles bestimmen, weil sie eben die meisten Guetzli haben. Irgendwie ist das ein Herunterbrechen aber eben auch eine Verfremdung der bestehenden Verhältnisse. Du willst bestehenden Verhältnissen den Spiegel vorhalten. Damit bist du aber nicht der erste, gibt es revolutionäre Kunstschaffende, die dir vorangegangen sind, die besonders grossen Einfluss auf dich hatten?
Ich hatte sehr viel Brecht gelesen – auch theoretische Sachen – bevor ich mich an das Album wagte. Eben auch, weil mich da diese Frage des Emotionen-Ablassens beschäftigte und ich mir die Frage stellen musste: Mach ich einfühlsame Sachen, wo jeder* auch befriedigt ist, wenn er es fertig hört oder mache ich etwas, was die Leute vielleicht irritiert? Grad für «Güetzi» oder auch für «Vorem Gsicht» waren schon die Dramen von Brecht wichtig. Aber auch Kafka mit seinen absurden Elementen. Du sagst, der Kapitalismus sei «dünn maskiert». Und das ist eine Frage, die mich als Künstler sehr beschäftigt. Wie dick ist die Maske? Wie und wie sehr verhülle ich meine Aussage? Das ist dann auch etwas, was man in diesem brechtschen Sinn beschreiben kann: Dadurch, dass es einfach Kinder sind, empfindet man es als viel stärker daneben und kann ein ganz anderes Urteil fällen.
 Hans Peter Gansner. Der US-amerikanische Schriftsteller und Fotograf Paul Bowles kehrte früh seiner Heimat den Rücken zu und zog nach Marokko, genauer nach Tanger. Seine Inspiration holte sich Bowles nicht zuletzt auch von Trancetänzen und Ritualen, die oft mit Kiff- und Majoun-Konsum verbunden waren. Ein Ausflug in die US-amerikanische Literatur im Jahr der Präsidentenwahl.
Hans Peter Gansner. Der US-amerikanische Schriftsteller und Fotograf Paul Bowles kehrte früh seiner Heimat den Rücken zu und zog nach Marokko, genauer nach Tanger. Seine Inspiration holte sich Bowles nicht zuletzt auch von Trancetänzen und Ritualen, die oft mit Kiff- und Majoun-Konsum verbunden waren. Ein Ausflug in die US-amerikanische Literatur im Jahr der Präsidentenwahl.