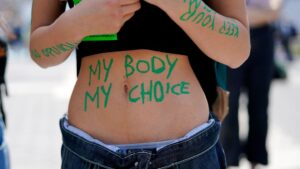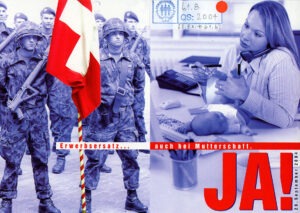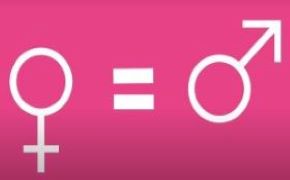Aufruf zum feministischen Streik vom 14.Juni 2023
Wir sind Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans, agender und queere Personen (FLINTAQ), mit oder ohne Partner:in, mit oder ohne Kinder; wir sind gesund oder krank, leben mit und ohne physische und psychische Beeinträchtigungen; wir sind jung, erwachsen, alt; wir sind Sexarbeiter:innen; wir sind Student:innen und Rentner:innen; wir sind in der Schweiz oder in einem anderen Land geboren und aufgewachsen; wir sind Migrant:innen und Geflüchtete, wir sind Teil unterschiedlicher Kulturen und haben unterschiedliche Herkünfte; wir sind lohnabhängig, selbstständig erwerbend oder erwerbslos arbeitend. Und wir alle rufen auf zu einem grossen feministischen Streik am 14.Juni 2023!
Am 14.Juni 2019 forderten über eine halbe Million Menschen am feministischen Streiktag ihre Rechte ein. Es war die grösste soziale Mobilisierung seit dem Landesstreik 1918. Die Aufbruchstimmung in eine gleichberechtigtere, feministischere Welt war überall spürbar. Einiges kam ins Rollen. Anderes bleibt blockiert oder wurde sogar schlimmer. Die AHV-21 ist nur eines von vielen Beispielen. Darum streiken wir am 14.Juni 2023 erneut bei der Arbeit, zu Hause, bei der Ausbildung, beim Konsum und im öffentlichen Raum. Schliesse dich den feministischen Bewegungen an! Mobilisiere deine Kolleg:innen, Freund:innen und Familienangehörigen für den feministischen Streik und organisiere eine Aktion, eine Demonstration oder eine Intervention.
Weltweit sind FLINTAQ die ersten Opfer autoritärer Regime, von Kriegen und Umweltzerstörung. Sie stehen auch oft an der Spitze von Widerstandsbewegungen. Wir sind solidarisch mit all diesen Kämpfen und teilen die Dringlichkeit, dem unterdrückerischen Patriarchat in all seinen Formen ein Ende zu setzen. Jin, Jiyan, Azadì. Frau. Leben. Freiheit.
Im Jahr 2023 fordern wir:
• Eine allgemeine Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ohne Intensivierung der Arbeit mit besseren Arbeitsbedingungen, einschliesslich eines Mindestlohns und Lohnerhöhungen in Branchen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. Es gilt dabei überall gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Das Gleichstellungsgesetz muss darum verschärft werden durch obligatorische Lohnanalysen, Kontrollen und Sanktionen bei Verstössen.
• Sofortige Stärkung der AHV und Abschaffung des Drei-Säulen-Systems in der Altersvorsorge zugunsten einer einzigen Säule: Kurzfristig lehnen wir die Abschaffung der Witwenrente ab und fordern, dass diese auf alle verwitweten Personen und Eltern, unabhängig von ihrem Geschlecht, ausgeweitet wird. Wir lehnen auch die BVG-21-Reform ab und fordern stattdessen die Stärkung der AHV, angefangen mit der Einführung einer
13.AHV-Rente. Langfristig: Abschaffung des Drei-Säulen-Rentensystems zugunsten einer einzigen solidarischen Säule und öffentlichen Altersvorsorge nach dem Modell der AHV, die den von der Verfassung verlangten Erhalt des Lebensstandards garantiert, sowie eine Rentenerhöhung und eine allgemeine Senkung des Rentenalters für alle. Alle Arten von Renten müssen Care-Aufgaben, die gratis geleistet werden, als Lohnarbeit für gleichwertige Arbeit anerkennen und berenten.
• Gesamtschweizerisch systematische Massnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt mit einem intersektionalen Ansatz, ausgestattet mit einem dauerhaften und umfangreichen nationalen Budget und basierend auf: Aufklärung und Prävention; einer Beobachtungsstelle für Gewalt; 24-Stunden-Nottelefonen und Beratung, Anlaufstellen, Notschlafstellen, Schutzhäusern mit ausreichend Plätzen und mit spezialisierten Fachkräften sowie eine angepasste therapeutische Nachsorge, um gewaltbetroffene FLINTAQ und ihre Kinder zu schützen, zu unterstützen und zu betreuen; Schulung und Ausbildung sämtlicher in strafrechtliche Fälle involvierter Berufsgruppen die uneingeschränkte und vorbehaltlose Umsetzung der Istanbul-Konvention, ein 2011 ausgearbeiteter und von der Schweiz 2017 ratifizierter völkerrechtlicher Vertrag, der verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt verlangt.
• Elternzeit für jede Erziehungsperson für mindestens ein Jahr pro Person und Kind, wobei Alleinerziehende gesamthaft die gleiche Dauer erhalten oder diese mit einer anderen Personen teilen können, die mit 100 Prozent Erwerbsersatz (EO) entschädigt wird und mit im Minimum einer Existenzsicherung, unabhängig vom Erwerbsstatus, und mit mindestens sechs Monaten Kündigungsschutz bei Rückkehr aus der Elternzeit, ohne Gefährdung des bestehenden Rechts auf Mutterschaftsurlaub und mit einem starken, kostenlosen und qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienst, um die Care-Arbeit (wie Erziehungs-, Haus- und Betreuungsarbeit) kollektiv zu übernehmen. Darum fordern wir eine dauerhafte Erhöhung der Finanzierung des Bundes für familienergänzende Betreuungsstrukturen: Das nationale Budget für die kollektive Kinderbetreuung muss erhöht werden, um den Bedürfnissen der Familien in ihrer Vielfalt gerecht zu werden.
• Abschaffung des privaten Krankenversicherungssystems und vollständige Übernahme der Kosten von reproduktiver und sexueller Gesundheit: Schaffung einer einheitlichen, öffentlichen Krankenkasse, die nach dem Prinzip der Umverteilung des Reichtums finanziert wird, um einen kostenlosen und bedingungslosen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für alle zu gewährleisten, inklusive der vollständigen Übernahme der Kosten für die reproduktive und sexuelle Gesundheit, unabhängig von Geschlecht, Familienkonstellationen und/oder Aufenthaltsstatus.
• Nationaler Plan und gesamtschweizerisch systematische Massnahmen zur Bekämpfung von rassistischer (Islamfeindlichkeit, anti-schwarzer Rassismus, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Asiafeindlichkeit), fremdenfeindlicher, queerfeindlich, behindertenfeindlicher Diskriminierung oder von Bodyshaming, der mit einem dauerhaften und umfangreichen nationalen Budget ausgestattet ist und auf folgenden Massnahmen beruht: Bildung, Prävention, Sensibilisierung; Nulltoleranz gegenüber diskriminierendem Verhalten; konkrete Umsetzung in der gesamten Gesellschaft; politische Teilhabe von Migrant:innen und Ausweitung ihrer politischen Rechte; gesetzliche Anerkennung aller Geschlechtsidentitäten; Sichtbarkeit und Anerkennung für Menschen mit Behinderung; Zugang zu Sport, Freizeit, Gesundheitsversorgung und Beschäftigungsmöglichkeiten ohne Diskriminierung aufgrund von Religion, Rassifizierung, Aufenthaltsstatus, Aussehen oder Gesundheitszustand.
• Feministisches Asyl und Aufenthaltsbewilligung: Asyl, Zugang und maximaler Schutz für FLINTAQ, denen aufgrund der Geschlechtsidentität sowie ihrer sexuellen Orientierung und/oder ihres feministischen Kampfes Gewalt angetan wird und die fliehen müssen. Anerkennung von geschlechtsspezifischer, homophober, transfeindlicher und sexualisierter Gewalt sowie von politischer Verfolgung als Fluchtgründe; Zugang für alle Betroffenen geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt zu spezialisierten Unterstützungsstrukturen – materiell, gesundheitlich und rechtlich – und Schutz für FLINTAQ, die von Gewalt betroffen sind, sei es in ihrem Herkunftsland oder während ihrer Migrationsgeschichte, einschliesslich in der Schweiz; Abschaffung des Nothilferegimes und Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen, besonders FLINTAQ und Kinder; Recht auf Familiennachzug für alle Geflüchteten und Migrant:innen; ein bedingungsloses jus soli für alle Personen, einschliesslich derjenigen ohne legalen Status, weil eine demokratische Gesellschaft nicht ein Viertel ihrer Bevölkerung ausschliessen darf, und für alle Personen, die in ihrem Herkunftsland und/oder während ihrer Migrationsgeschichte, einschliesslich in der Schweiz, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt erlitten haben.
• Nationaler Aktionsplan und Massnahmen für Klima und Umwelt: Sofortige Anerkennung des Klimanotstandes, der Umweltzerstörung und des Zusammenbruchs der biologischen Vielfalt, die das Leben bedrohen; Sofortige und konsequente Investitionen in nachhaltige Technologien und die Erarbeitung und Finanzierung ganzheitlicher Strategien mit dem Ziel der Klimagerechtigkeit, dies in internationaler Zusammenarbeit; Debatte über den Umbau unseres Wirtschaftssystems, von dem nur eine Minderheit profitiert, während die Mehrheit der Weltbevölkerung ausgebeutet wird und in Armut lebt; Der Aktionsplan ist speziell auf Institutionen, Unternehmen, Grosskonzerne und den Finanzplatz ausgerichtet. Es werden verbindliche Massnahmen und Sanktionen festgeschrieben; Einführung eines lokaleren, solidarischen und ökologischen Systems der Nahrungsmittelproduktion/-verteilung; echte Ernährungssouveränität und gegen das Monopol der Agrarwirtschaftslobbys.
• Verankerung eines intersektionalen Feminismus in der Bildung: Anwendung und Vermittlung von unter anderem queerfeministischen, antirassistischen, anti-Body-shaming, behinderteninklusiven und ökosozialistischen Werten, einschliesslich der Sexual- und Zustimmungserziehung, durch die Lehrpläne und durch Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in diesem Bereich, eine Aufstockung der finanziellen Mittel und eine Erneuerung der Bildungsmaterialien.
• Recht auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung für alle unabhängig vom Aufenthaltsstatus oder Geschlecht: Der Schwangerschaftsabbruch soll zudem aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und stattdessen im Zivilgesetzbuch geregelt werden.