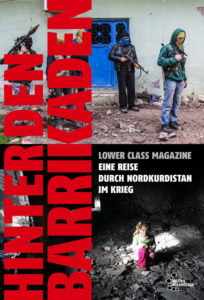Abschottung und Aufrüstung
 Grenzen zu und mehr Militär – so will die EU «besser werden». Am Gipfeltreffen von Mitte September beschlossen die EU-ChefInnen mit dem «Fahrplan von Bratislava», wie sie der «Krise» Herr werden wollen. Fahrplan einer Fahrt, die in die falsche Richtung geht.
Grenzen zu und mehr Militär – so will die EU «besser werden». Am Gipfeltreffen von Mitte September beschlossen die EU-ChefInnen mit dem «Fahrplan von Bratislava», wie sie der «Krise» Herr werden wollen. Fahrplan einer Fahrt, die in die falsche Richtung geht.
Sie klangen tatsächlich ziemlich alarmiert, die EU-Oberen, die am 16. September zum Gipfeltreff in Bratislava zusammenkamen. Kommissionspräsident Juncker hatte zwei Tage vorher in seiner Rede vor dem EU-Parlament eine «existenzielle Krise» der EU ausgemacht. Aber auch Kanzlerin Merkel meinte bei ihrer Ankunft in Bratislava: «Wir sind in einer kritischen Situation». Es müsse jetzt darum gehen, «durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können.»
Zugleich sollte allerdings nicht übersehen werden, dass das alarmistische Krisengerede auch einen Zweck verfolgt. «Mehr Geschlossenheit zeigen», heisst die Parole. Gemeint ist damit, dass die verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten sich wieder mehr den von den Führungsmächten gewollten Vorgaben unterordnen und auf «Eigenmächtigkeiten» verzichtet sollen. Die EU sei «zwar nicht fehlerfrei», aber doch «das beste Instrument, über das wir verfügen», heisst es in der von den Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen verabschiedeten «Deklaration von Bratislava». Die führenden Kapitalkreise und ihre politischen AkteurInnen brauchen die EU als Instrument zur Durchsetzung ihrer Interessen nach innen und aussen. Deshalb wollen und werden sie mit aller Entschlossenheit an der Fortentwicklung und dem Ausbau der EU festhalten.
Die EU-Armee kommt
Die «Deklaration von Bratislava» verdeutlicht, wie die EU Chefs die derzeitige «kritische Situation» in den Griff bekommen wollen und wohin die Reise in den nächsten Monaten gehen soll. Kernaussage: Es gehe jetzt vor allem darum, «die politische Kontrolle über die Entwicklungen sicherzustellen». Dazu wurde in Bratislava als Anhang zur verabschiedeten «Deklaration» auch ein «Fahrplan» mit den «Kernprioritäten» für die nächsten Monate verabschiedet. Nach diesem «Fahrplan» konzentriert sich das «Besserwerden» der EU in den nächsten Monaten im Wesentlichen auf zwei Hauptpunkte: Erstens auf die weitere Abschottung der EU gegen Menschen auf der Flucht und zweitens auf den Ausbau der EU-Militärmacht.
Zum Flüchtlingsthema wird unter anderem das «uneingeschränkte Festhalten» an dem schändlichen Abschiebeabkommen mit dem autoritären Erdogan-Regime in der Türkei sowie die Erhöhung der Zahl der Frontex-GrenzschützerInnen an der Grenze Bulgariens zur Türkei festgeschrieben. Bis Ende des Jahres soll die EU-Grenz- und Küstenwache weiter ausgebaut werden. Doch die eigentliche Streitfrage zwischen den beteiligten Staaten, nämlich die EU-weite Aufteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Staaten nach einem von der EU festgelegten Schlüssel, wurde mit keinem einzigen Wort angesprochen.
Die EU-Oberen geben vor, mit ihren «Massnahmen» dem Anwachsen rechtsextremistischer Kräfte in der EU entgegenwirken zu wollen. Aber in Wahrheit übernehmen sie damit nur die Verwirklichung der rechtsextremistischen Forderungen und Parolen als EU-eigene Politik. Der zweite Hauptpunkt des Bratislava-Fahrplans ist der Ausbau der Militärmacht. Ein Kernpunkt ist dabei die Einrichtung eines ständigen «EU-Militärhauptquartiers für Auslandseinsätze» nach einem kurz vorher von Merkel und Hollande gemeinsam vorgelegten Vorschlag. Kommissionschef Juncker plädierte vor dem EU-Parlament auch für die Schaffung «gemeinsamer militärischer Mittel», die, so wörtlich, «in einigen Fällen auch der EU gehören sollten». Also eigene Truppenteile als Kern einer künftigen «EU-Armee». Davon soll dann vor allem die EU-Rüstungsindustrie profitieren, bei der die EU neue Ausrüstungen bestellt. Denn «eine starke europäische Verteidigung braucht eine innovative europäische Rüstungsindustrie», betonte Juncker.
Eine Erkenntnis bleibt
Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik hingegen gibt es im «Fahrplan von Bratislava» kaum nennenswertes Neues. Die von Brüssel diktierte rigorose Spar- und Kürzungspolitik wird mit keinem Wort erwähnt. Noch weniger natürlich Vorstellungen, wie etwa der Einführung eines verbindlichen europäischen Mindestlohns oder der Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine EU-weite Festschreibung der Verkürzung der Arbeitszeiten. Ganz zu schweigen von Massnahmen zur Reduzierung der ungleichen und ungerechten Verteilung des Reichtums. Es bleibt bei der Erkenntnis: Fortschritte in diese Richtung sind nicht «von oben» zu erwarten. Sie müssen von den Völkern selbst erkämpft werden.
Aus dem vorwärts vom 21. Oktober 2016 Unterstütze uns mit einem Abo.