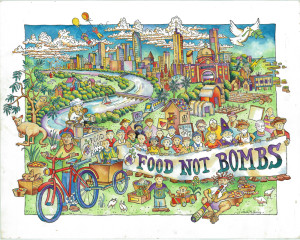Die Festung Europa überwinden – nur wie?
 Seit Anfang März sitzen Menschen auf dem Weg nach Europa fest, nicht nur in Idomeni, dem griechischen Festland, auf den Inseln oder in der Türkei, sondern auch in Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Ja, eigentlich überall. Wirklich? Und vor allem: Wie lange?
Seit Anfang März sitzen Menschen auf dem Weg nach Europa fest, nicht nur in Idomeni, dem griechischen Festland, auf den Inseln oder in der Türkei, sondern auch in Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Ja, eigentlich überall. Wirklich? Und vor allem: Wie lange?
Mit immer brachialeren Mitteln versuchen die Behörden, die Leute von der Überquerung ebenjener Grenzen abzuhalten, die vor zwei Monaten semipermeabel, vor einem halben Jahr ganz und gar durchlässig waren. Dabei zögern die eigentlichen Verantwortlichen für dieses Elend, PolitikerInnen aller Couleurs und ihre mandatierten Sicherheitskräfte, nicht, die vielen Freiwilligen, die seit Monaten deren Arbeit machen, als AnstifterInnen der Proteste und Durchbruchsversuche, als Feinde der Demokratie hinzustellen. Die Frage wird ihnen aber überall gestellt: Wieviel müssten wir sein, um den Sommer 2015 zu wiederholen? Und so ist es auch kein Wunder, dass kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht von Protesten, Durchbruchsversuche, Hungerstreiks oder einer Besetzung aus Griechenland und anderswo unterrichtet werden. Tatsache ist, dass sich die Mehrheit der Freiwilligen davon distanziert. Ohne jedoch den Zurückgebliebenen eine Alternative zu bieten. Jenu, gehen wir dem selbst nach.
Das Nadelöhr
Es gibt, tatsächlich, neue Wege, um legal nach Europa und auch in die Schweiz zu gelangen. Gemäss den beiden 2015 verabschiedeten Relocation programs sollten 160 000 Personen von Griechenland und Italien in andere EU-Staaten, Schweiz inklusive, umgesiedelt werden. Tatsächlich haben bisher insgesamt knapp 7000 Menschen von diesem Programm profitiert, die Hälfte davon aus Italien, 413 landeten schliesslich in der Schweiz. Wobei allein in den letzten drei Monaten mehr als 150 000 Personen nach Griechenland gelangten. Es dürfen denn auch nur Menschen aus Syrien, dem Irak, Eritrea, der Zentralafrikanischen Republik, dem Jemen, Swaziland oder Bahrain daran teilnehmen. Die eigentliche Crux ist aber, dass kein einziger Staat zu deren Übernahme verpflichtet ist. So verpuffen die vollmundigen Worte der EntscheidungsträgerInnen wie warme Luft, und mit ihnen die Hoffnungen der meisten MigrantInnen. Registrierte SyrerInnen in der Türkei dürfen zudem gemäss EU-Türkei-Deal ein Resettlement beantragen und direkt ab Istanbul in ein europäisches Land fliegen, sofern sich ein solches findet (siehe oben). Allerdings ist nach wie vor ziemlich alles unklar diesbezüglich, und geschafft haben es so bisher lediglich 79 Personen – von 2,75 Millionen AnwärterInnen! Dazu gibt es zu sagen, dass auch SyrerInnen mittlerweile eines Visums bedürfen, um in die Türkei einzureisen, und gewöhnlich auf der anderen Seite der neu gebauten Mauer an der Grenze zum syrischen Konfliktgebiet zurückgehalten oder gar dorthin zurückgebracht werden. Besonders fürchten müssen schliesslich die Staatsangehörigen derjenigen Länder, die ein Rückübernahmeabkommen mit der Türkei besitzen, unter anderem Belarus, Kirgisistan, Moldawien, Nigeria, Pakistan, Russland, eben Syrien, aber auch die Ukraine und der Jemen. Ausser SyrerInnen haben Menschen, die nicht aus Europa stammen, keine Möglichkeit, die Türkei um Asyl zu bitten. Das Land feilscht zudem zurzeit mit folgenden Ländern um weitere Rückübernahmeabkommen: Iran, Irak, Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Kamerun, Eritrea, Marokko, Ghana, Myanmar, die Republik Kongo, Somalia, dem Sudan und Tunesien. Die Türkei ist also für die meisten weit davon entfernt, ein sicheres Land zu sein, auch wenn sie dies in amtlichen Papieren bescheinigt und in Schnellverfahren umsetzt.
Mauern, Mafia, Vigilantes
Viele Alternativen entlang der Balkanroute wurden letztlich hierzulande kolportiert. Tatsache ist, dass offensichtlich bisher keine davon zu überzeugen vermochte. Nicht umsonst avancierte letzten Sommer die mazedonisch-griechische Grenze zum Haupteintrittstor nach Europa. Was die meisten verschweigen oder vielleicht gar nicht wissen: Davor war die Situation in Südosten Europas auch nicht anders. Die Leute blieben jahrelang stecken: in knastähnlichen Strukturen, als Sans-Papiers in der Landwirtschaft oder Gastronomie oder aber, den Nazis ausgesetzt, unter freiem Himmel. Noch nie war Albanien zum Beispiel eine Alternative zu den Lastwagen-Containern in Patras und Igoumenitsa. Ganz einfach aus dem Grund, dass das Land einen der gefährlichsten Mafia-Clans auf der Welt beheimatet, der zudem eng mit den staatlichen Strukturen verknüpft ist. Das wissen die Leute, und drum meiden sie Albanien. Und das ist gut so. Bulgarien wird offenbar neuerdings von denjenigen genutzt, die in Serbien steckengeblieben sind und es nicht nach Ungarn oder Kroatien schaffen. An Bulgariens Grenzen haben sich mittlerweile sogenannte Vigilantes, paramilitärische Bürgerwehren, gebildet, die Eingereiste jagen, festnehmen, schlagen…. Im Süden verfügt das Land bekanntlich über einen EU-finanzierten Stacheldrahtzaun, der auch von Schweizer GrenzwächterInnen mit bewacht wird. Obwohl die Einreisezahlen im letzten Quartal entgegen den Vorhersagen von PolitikerInnen und ExpertInnen um 20 Prozent zurückgingen, rüstet die dortige Armee gegen den offensichtlich ausbleibenden «Einmarsch der Elenden» auf, wozu auch die Schwarzsee-Flotte eingebunden wurde. Bulgarien ist schliesslich Dublin-Erstasylland, die Asylstrukturen desolat, die Gefahr gross, Opfer von Menschenhandel zu werden. Wohin also, wenn nicht legal oder über Südosteuropa?
Wer kann, fliegt
Anzeichen gibt es anscheinend, dass zurzeit grössere Bootsfahrten aus dem Süden der Türkei direkt nach Italien vorbereitet würden. Diese Ansicht widerspricht komplett der Tatsache, dass die Türkei, zumindest bis zum Eintritt in die Schengenzone diesen Sommer, absolut kein Interesse daran hat, den Deal mit der EU zu torpedieren. Das totalitäre Regime von Ankara hat seit Jahresanfang selbstredend beinahe achtmal mehr Personen an der Überfahrt gehindert als im ersten Vorjahresquartal und scheint tatsächlich gewillt, Menschen weder über Land noch Wasser unkontrolliert nach Europa reisen zu lassen. Wer kann, fliegt also, und zwar in ein Land, für das er oder sie kein Visum braucht oder eines leicht ergattern kann. Letzthin las ich von einem, der es über Brasilien und Französisch-Guayana nach Europa schaffte. Das dürfte die Ausnahme bleiben. Zeigt aber, wie überlegen ein einzelner Mensch gegenüber einem Staat, ja Staatenbund, sein kann oder ist. Zurück zum Mainstream. Zugenommen haben in den letzten Wochen zum Beispiel die 1500 Kilometer langen Bootsüberfahrten von Flüchtlingen aus Ägypten nach Italien. Dort wurde im November 2015 ein neues Gesetz eingeführt, dass illegale Ein- und Durchreisen mit Gefängnis bestraft. Die Grenzkontrollen wurden vor allem im Süden verstärkt: Allein im Dezember wurden gemäss der Regierung 22 026 Personen geschnappt. Doch zu ihrem Verbleib und dem derjenigen, die sich einer Kontrolle entziehen konnten, gibt es kaum verlässliche Informationen. Kein Wunder: Nichtregierungs- und ganz besonders Menschenrechtsorganisationen werden dort immer stärker verfolgt; viele existieren gar nicht mehr, deren ExponentInnen wurden gebüsst, verhaftet, angeklagt, verurteilt, mehrere gefoltert und einige sind gar spurlos verschwunden.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Wie alle anderen nordafrikanischen Staaten haben auch Ägypten und Libyen selbst für SyrerInnen einen Visumszwang eingeführt. In Libyen warten bekanntlich seit Jahren Abertausende von MigrantInnen auf die Überfahrt nach Italien, viele von ihnen in Gefängnissen, sei es von der sogenannten Übergangsregierung, dem IS, der SchmugglerInnen oder sonst irgendwelcher Clans, die von ihrem Elend profitieren wollen. Wer empört ist über den EU-Türkei-Deal, sollte gefälligst auch nach Libyen schauen: 2009 schloss der damalige italienische Ministerpräsident Berlusconi mit dem damaligen libyschen Staatschef Ghaddafi ein Rückübernahmeabkommen, das als Vorläufer des heutigen Deals mit der Türkei gelten kann und nur deshalb nicht mehr funktioniert, weil Ghaddafi 2011 aus dem Land gebombt und umgebracht wurde. Seitdem herrscht Krieg, der damalige Transfer an Know-how und technischen Hilfsmitteln wird nun im Konflikt eingesetzt. Dennoch lässt die EU im Hintergrund keine Gelegenheit aus, um in diesem Chaos die Migration aus Libyen zu steuern zu versuchen. Kaum ist der EU-Türkei-Deal unter Dach und Fach, denkt zum Beispiel Deutschland im Ernst darüber nach, Libyen zu einem sicheren Drittstaat zu deklarieren, und strebt dabei nach einer Übereinkunft mit einer soeben durch westlichen Druck eingesetzten Einheitsregierung, die prophylaktisch bereits angefangen hat, abfahrende Flüchtlingsboote abzufangen und die Reisenden zu inhaftieren.
Was tun?
Bleibt also noch der Weg über Marokko, dem eigentlichen Prototypen des EU-Türkei-, beziehungsweise des Italien-Libyen-Deals. Das erste Rückübernahme-Abkommen mit Marokko unterzeichnete Spanien 1992, doch erst zwanzig Jahre später begann es, zu greifen. Ab Mitte der 90er-Jahre nahmen die EU-Staaten Marokko mittels Freihandelsabkommen in die Zange, 1999 erarbeiteten sie einen «Aktionsplan Migration», der erstmals auch die Übernahme von «Staatsangehörigen von Drittländern und Staatenlosen» vorsah, «die nach ihrer Ankunft aus Marokko in das Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten illegal eingereist oder dort illegal verblieben sind». Tatsächlich sind die Aurseisezahlen nach Europa dort zusammengebrochen. «Pushbacks» sind an den Enklaven von Ceuta und Melilla an der Tagesordnung, nur wenige Boote wagen es über die Gibraltar-Meerenge oder zu den Kanarischen Inseln. Razzien in Treffpunkten und Aufenhaltsorten von MigrantInnen sowie Haft und Deportationen in den Süden des Landes bis hin zur Grenzek, haben in Marokko massiv zugenommen. Was tun? Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Grenzen in Südosteuropa zurzeit zu militarisiert und propagiert sind, als dass dort heuer eine Wiederholung der Ereignisse von letztem Sommer möglich wäre. Was wir aber wissen: Was die MigrantInnen letztes Jahr da erreichten, kann durchaus anderswo gelingen. Wir werden die Behörden also weiterhin genau beobachten und dann überraschen.
Aus dem vorwärts vom 26. April 2016 Unterstütze uns mit einem Abo!