Ausschaffung trotz Todesgefahr
Elf ganze Jahre lebt Diyara bereits in der Schweiz. Ein Drittel seines Lebens hat er hier verbracht. Diyara hat sich ein neues Leben in der Schweiz aufgebaut. Er lebt allein in einer kleinen Wohnung, die er selbst finanziert. Denn Diyara arbeitet in einem der grossen Hotels Zürich, zusammen mit 150 anderen KollegInnen. «Sie haben mich in der Zeit alle unterstützt. Viele sind Freunde geworden.» Diyara spricht gutes Deutsch, nicht akzentfrei und nicht ganz ungebrochen, aber man versteht ihn sehr genau.
Flucht aus dem Irak
Wenn man aber nun mit ihm spricht, dann versteht man vor allem eines: Diyara hat Angst. Dabei ist er bestens integriert. Freundeskreis, Spracherwerb, Arbeit. Darüber hinaus engagiert sich Diyara politisch, denn er ist Mitglied der IFIR, der «International Federation of Iranian Refugees», einer Organisation, die sich der Verteidigung von Flüchtlings- und Menschenrechten verschrieben hat. Diyara lebt nicht nur für sich. Ihm ist die Solidarität mit anderen, denen es ähnlich geht wie ihm, wichtig. Denn er kennt die unmenschlichen Zustände und das Gefühl, verfolgt und gehetzt zu werden. «Im Irak hatte ich Probleme mit radikalen Islamisten. Ich habe mit ihnen zusammen studiert, diese Leute kennen mich.» Und sie jagen ihn, denn wenn Diyara etwas nicht ist, dann Islamist. Das ging so weit, dass Diyara sich nicht mehr auf der Strasse zeigen konnte. «Das eine Mal ging ich mit meiner Verlobten durch die Stadt. Wir waren achtlos. Und als sie uns gesehen haben, haben sie nicht nur mich, sondern auch meine Freundin verprügelt. Das andere Mal hatten wir einfach Glück. Ich habe noch gesehen, wie ein Auto angefahren kam. Als Männer ausstiegen mit Kalaschnikows, sind meine Freundin und ich weggerannt ? und sie haben auf uns geschossen.».
Das sind Zustände, die für Diyara real sind. Für das Migrationsamt gilt das als «nicht glaubwürdig». «Ich habe dann mehr als einen Monat nicht mehr das Haus meiner Eltern verlassen. Und dann bin ich geflüchtet.» Aber so eine Flucht ist teuer, Diyaras ganze Familie musste ihm helfen, ein Onkel musste seinen Laden verkaufen. Und so eine Flucht ist gefährlich, sie dauert lange, sie lässt sich nur mit der Hilfe von Menschenschleppern organisieren. Über den Iran ging die Reise für Diyara, bis er schliesslich in der Schweiz ankam. «Ich konnte es niemandem sagen. Meine Familie wusste es, und meine Verlobte wusste es auch. Aber all meine Freunde und Bekannten musste ich zurücklassen, ich durfte ihnen nichts sagen. Es war zu gefährlich.» Seine Verlobte hat er da zum letzten Mal gesehen. Später floh auch sie nach Syrien. «Für eine kurze Zeit hatten wir noch Kontakt. Aber dann auf einmal nicht mehr. Ich weiss nicht, was aus ihr geworden ist.» Es ist ein ganzes Leben, dass Diyara aufgeben musste, um zu überleben. Und Diyara weiss, dass es im Irak nicht besser geworden ist. «Diese Leute sind immer noch da. Und sie kennen mich. Und auch im Irak ist nichts besser geworden. Meine Familie erzählt es mir immer wieder, es ist durch den Krieg dort alles nur noch schlimmer geworden. Nichts hat sich gebessert.»
Verhaftet und entwürdigt
In der Schweiz angekommen, bemühte sich Diyara um Asyl. Und er erhielt die F-Aufenthaltsbewilligung. An sein altes Leben konnte er dennoch nicht anknüpfen. Im Irak war er Student und hatte drei Jahre lang als Bauingenieur studiert. Nur ein Jahr fehlte ihm bis zum Abschluss. In der Schweiz verweigerte man ihm die Fortführung seines Studiums. So begann er, in einem Hotel zu arbeiten. Vermutlich würde Diyara mit diesem Leben glücklich werden, aber man lässt ihn nicht. 2007 entzog man ihm die Aufenthaltsbewilligung und kündigte seine Ausschaffung an. Er legte Rekurs ein, vor vier Monaten wurde dieser abgelehnt. Und vor zwei Wochen holte man ihn. «Ich war am arbeiten, da kamen die Polizisten ins Hotel. Sie legten mir Handschellen an und führten mich vor allen Leuten und Arbeitskollegen ab.» Eine Demütigung: «Sie müssen doch glauben, ich sei ein Verbrecher. Dabei habe ich einfach keine Papiere.» Von der Arbeit brachte man Diyara zuerst auf eine Polizeistation, dann in das «provisorische» Gefängnis am Kasernenareal. Dabei handelte die Polizei unverantwortlich. «Ich bin krank und habe Schmerzen. Ich habe eine Prostataentzündung und muss regelmässig Medikamente nehmen.» Medikamente, die man Diyara nicht mehr ausreichend zur Verfügung stellt. Die Entzündung flackerte innerhalb von nur zwei Tagen wieder auf, sein Zustand verschlechterte sich rapide, bis man ihn schliesslich ins Unispital einweisen lassen musste. «Die Ärzte sagen, dass ich eine weiche Fläche brauche. Im Gefängnis gab es nur einen harten Holzstuhl, man hatte nicht mal eine Decke über den Tag und es war kalt.» Indem die Polizei allerdings fahrlässig die Gesundheit von Diyara riskierte, sorgten sie immerhin dafür, dass er aus der Haft kam. Man entliess Diyara anfangs November aus dem Krankenhaus. Er durfte gehen, aber er muss – auch dank der Polizei – noch mindestens weitere vier Wochen Medikamente einnehmen.
Momentan ist Diyara frei. Er arbeitet wieder. An ein irgendwie normales Leben ist aber nicht zu denken. Man hat ihm seine Hausschlüssel weggenommen, er muss also bei einem Freund unterkommen. Noch dazu verfolgt ihn die Angst. «Natürlich habe ich Angst. Es geht mir schlecht, ich habe Schmerzen. Ich habe Angst, dass ich wieder ins Gefängnis komme und dass sie mich in den Irak schicken.» Auf die Frage, was dort mit ihm wohl passieren würde, gibt Diyara eine lapidare Antwort: «Sie würden mich zu Tode jagen.» Es gibt nur Unverständnis, auch Diyara kann es nicht verstehen. «Dabei bin ich doch kein Verbrecher. Ich habe nie etwas getan.»

 Rund 5000 Personen nahmen am Samstag, dem 1. Oktober, an der gesamtschweizerischen Sans-Papiers-Demo in Bern teil. Der Zusammenschluss der schweizerischen Sans-Papiers-Bewegung forderte dabei eine Abkehr von der heuchlerischen Politik im Umgang mit Sans-Papiers.
Rund 5000 Personen nahmen am Samstag, dem 1. Oktober, an der gesamtschweizerischen Sans-Papiers-Demo in Bern teil. Der Zusammenschluss der schweizerischen Sans-Papiers-Bewegung forderte dabei eine Abkehr von der heuchlerischen Politik im Umgang mit Sans-Papiers.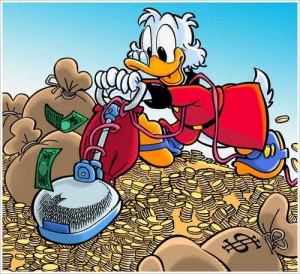 2010 haben die 41 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen alle einen Gewinn erzielen können – im Gegensatz zum Jahr 2009, als neun Konzerne Verluste hinnehmen mussten. Insgesamt stiegen die Gewinne um 75 Prozent auf den neuen Rekordwert von 83,9 Milliarden Franken. Am stärksten stiegen die Gewinne in der Nahrungsmittelindustrie und bei den Banken und Versicherungen. Aber auch die MEM-Industrie konnte wieder ansehnliche Gewinne erzielen.
2010 haben die 41 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen alle einen Gewinn erzielen können – im Gegensatz zum Jahr 2009, als neun Konzerne Verluste hinnehmen mussten. Insgesamt stiegen die Gewinne um 75 Prozent auf den neuen Rekordwert von 83,9 Milliarden Franken. Am stärksten stiegen die Gewinne in der Nahrungsmittelindustrie und bei den Banken und Versicherungen. Aber auch die MEM-Industrie konnte wieder ansehnliche Gewinne erzielen. Die Schweizerische Politik gegenüber uns Sans-Papiers ist von Heuchelei bestimmt. Wir sind als billige Arbeitskräfte in unbeliebten Berufen willkommen, als Menschen mit Rechten aber nicht. Wir bauen eure Strassen und Häuser, betreuen eure Kinder, pflegen eure kranken und betagten Angehörigen, arbeiten auf euren Feldern, in Hotels und Restaurants. Damit tragen wir zum Wohlstand der Schweiz bei.
Die Schweizerische Politik gegenüber uns Sans-Papiers ist von Heuchelei bestimmt. Wir sind als billige Arbeitskräfte in unbeliebten Berufen willkommen, als Menschen mit Rechten aber nicht. Wir bauen eure Strassen und Häuser, betreuen eure Kinder, pflegen eure kranken und betagten Angehörigen, arbeiten auf euren Feldern, in Hotels und Restaurants. Damit tragen wir zum Wohlstand der Schweiz bei. An dem Samstag des 19. März klafften Wetter und Szenerie weit auseinander: Trüb, nass und kalt war der Tag, dennoch wurden die Strassen Zürichs von Menschenkolonnen und Fahnenmeer erhellt. Gute drei- bis vierhundert Demonstranten versammelten sich, um anlässlich des 100. Internationalen Frauenkampftages ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung der Frau zu setzen. Dabei kamen alle die zusammen, die sich als links und/oder progressiv verstehen: Mit Unia, VPOD und Syndicom waren die grösseren Gewerkschaften Zürichs ebenso anwesend wie PdA, Junggrüne und Juso. Darüber hinaus zeigten sich auch der revolutionäre Aufbau und die MLKP durch ihre Teilnahme solidarisch. Besonders interessant: Etwa gleich viele Männer wie Frauen demonstrierten – eventuell mit der leichten Tendenz zur Frauenmehrheit.
An dem Samstag des 19. März klafften Wetter und Szenerie weit auseinander: Trüb, nass und kalt war der Tag, dennoch wurden die Strassen Zürichs von Menschenkolonnen und Fahnenmeer erhellt. Gute drei- bis vierhundert Demonstranten versammelten sich, um anlässlich des 100. Internationalen Frauenkampftages ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung der Frau zu setzen. Dabei kamen alle die zusammen, die sich als links und/oder progressiv verstehen: Mit Unia, VPOD und Syndicom waren die grösseren Gewerkschaften Zürichs ebenso anwesend wie PdA, Junggrüne und Juso. Darüber hinaus zeigten sich auch der revolutionäre Aufbau und die MLKP durch ihre Teilnahme solidarisch. Besonders interessant: Etwa gleich viele Männer wie Frauen demonstrierten – eventuell mit der leichten Tendenz zur Frauenmehrheit. Unterschiede in Bezahlung und Karrierechancen der Frau zu verzeichnen. So werden Frauen für gleiche Arbeit gänzlich ungleich entlöhnt: Um durchschnittlich 19% ist der Lohn einer Frau geringer als der eines Mannes, wobei dieser Unterschied im öffentlichen Bereich mit 16% ein wenig geringer, im privaten Wirtschaftssektor mit 24% besonders krass ausfällt. Und während diese Ungleichheit in zwei von drei Fällen scheinheilig mit Ausbildung, Erfahrung oder Kompetenz
Unterschiede in Bezahlung und Karrierechancen der Frau zu verzeichnen. So werden Frauen für gleiche Arbeit gänzlich ungleich entlöhnt: Um durchschnittlich 19% ist der Lohn einer Frau geringer als der eines Mannes, wobei dieser Unterschied im öffentlichen Bereich mit 16% ein wenig geringer, im privaten Wirtschaftssektor mit 24% besonders krass ausfällt. Und während diese Ungleichheit in zwei von drei Fällen scheinheilig mit Ausbildung, Erfahrung oder Kompetenz  Frauenbündnis 8. März. Kritik kam hier von mehreren Seiten. Einigen Gewerkschaftsmitgliedern stiess es sauer auf, dass diese Demonstration unbewilligt war, andere griffen den Ausschluss der Männer als falsch an. Demgegenüber wies der revolutionäre Aufbau (auch vertreten im 8.März Frauenbündnis) darauf hin, dass die Demonstration vom 19. März die langjährige Tradition des 8.März-Frauenbündnisses und deren Diskussionen rund um ihre Konzept ignoriert. Relativ unbestritten aber ist, dass dieser Zustand eine Spaltung der Kräfte bedeutet. Der Sache an sich ist die Spaltung natürlich wenig nützlich: Sie spielt den Bürgerlichen, denen wenig an Gleichberechtigung gelegen ist, in die Hände, denn sie ermöglicht eine Diskreditierung der Bewegung mit Verweis auf deren „geringe Zahl“. Eine andere Tragik liegt allerdings darin, dass der Internationale Frauenkampftag eine Institution darstellt, deren Motivation und Ziel eine der wenigen Chancen zur Zusammenarbeit zwischen den revolutionären und den (noch) bürgerlich-progressiven Kräften ermöglichen würde. Eine Chance, die auch genutzt werden könnte, um für die eigene Sache zu werben. Dazu bedürfte es wohl zweierlei: Gewerkschaften wie auch Jungparteien müssten ihre unbegründete Abneigung gegenüber revolutionär eingestellten Gruppen zugunsten der gemeinsamen Sache überwinden und das bestehende Frauenbündnis müsste die Debatte um die Teilnahme von Männern an der Demonstration ein weiteres Mal offen führen. In der Hinsicht stiftet es Hoffnung, dass auf der Schlusskundgebung dieser Demonstration ganz offen und ganz klar gesagt wurde, dass es „Sozialistinnen waren, die den Frauentag schufen“. Vielleicht wurde da mehr verstanden, als man es bisher dachte.
Frauenbündnis 8. März. Kritik kam hier von mehreren Seiten. Einigen Gewerkschaftsmitgliedern stiess es sauer auf, dass diese Demonstration unbewilligt war, andere griffen den Ausschluss der Männer als falsch an. Demgegenüber wies der revolutionäre Aufbau (auch vertreten im 8.März Frauenbündnis) darauf hin, dass die Demonstration vom 19. März die langjährige Tradition des 8.März-Frauenbündnisses und deren Diskussionen rund um ihre Konzept ignoriert. Relativ unbestritten aber ist, dass dieser Zustand eine Spaltung der Kräfte bedeutet. Der Sache an sich ist die Spaltung natürlich wenig nützlich: Sie spielt den Bürgerlichen, denen wenig an Gleichberechtigung gelegen ist, in die Hände, denn sie ermöglicht eine Diskreditierung der Bewegung mit Verweis auf deren „geringe Zahl“. Eine andere Tragik liegt allerdings darin, dass der Internationale Frauenkampftag eine Institution darstellt, deren Motivation und Ziel eine der wenigen Chancen zur Zusammenarbeit zwischen den revolutionären und den (noch) bürgerlich-progressiven Kräften ermöglichen würde. Eine Chance, die auch genutzt werden könnte, um für die eigene Sache zu werben. Dazu bedürfte es wohl zweierlei: Gewerkschaften wie auch Jungparteien müssten ihre unbegründete Abneigung gegenüber revolutionär eingestellten Gruppen zugunsten der gemeinsamen Sache überwinden und das bestehende Frauenbündnis müsste die Debatte um die Teilnahme von Männern an der Demonstration ein weiteres Mal offen führen. In der Hinsicht stiftet es Hoffnung, dass auf der Schlusskundgebung dieser Demonstration ganz offen und ganz klar gesagt wurde, dass es „Sozialistinnen waren, die den Frauentag schufen“. Vielleicht wurde da mehr verstanden, als man es bisher dachte. 1.500 Menschen demonstrierten gestern gegen eine geplante Budgetkürzung in Zürich. 220 Millionen Franken sollen eingespart werden, davon 60 Millionen beim Personal. Die Demonstranten -Gewerkschafter und Angestellte im öffentlichen Bereich- äusserten ihren Unmut über die bürgerliche Sparpolitik vor dem Rathaus.
1.500 Menschen demonstrierten gestern gegen eine geplante Budgetkürzung in Zürich. 220 Millionen Franken sollen eingespart werden, davon 60 Millionen beim Personal. Die Demonstranten -Gewerkschafter und Angestellte im öffentlichen Bereich- äusserten ihren Unmut über die bürgerliche Sparpolitik vor dem Rathaus. Zürich steht still!
Zürich steht still! Die Schlusskundgebung
Die Schlusskundgebung Zum Auftakt der diesjährigen 8. März-Kampagne sollte am Abend des 26. Februars 2011 auf dem Helvetiaplatz in Zürich ein öffentliches Tanzvergnügen stattfinden. Dies wurde durch die massive Repression der Polizei verunmöglicht.
Zum Auftakt der diesjährigen 8. März-Kampagne sollte am Abend des 26. Februars 2011 auf dem Helvetiaplatz in Zürich ein öffentliches Tanzvergnügen stattfinden. Dies wurde durch die massive Repression der Polizei verunmöglicht. Am 6. Februar wurde das Weltsozialforum in Dakar mit einer beeindruckenden Karawane eröffnet. Die Karawane war mit 50.000 Teilnehmern eine friedliche, bunte, musikalische und lebendige Demonstration für eine bessere Welt.
Am 6. Februar wurde das Weltsozialforum in Dakar mit einer beeindruckenden Karawane eröffnet. Die Karawane war mit 50.000 Teilnehmern eine friedliche, bunte, musikalische und lebendige Demonstration für eine bessere Welt. Die Jahresbilanzen der UBS sind nun bekannt: Die UBS machte im Jahr 2010 einen Gewinn von 7,16 Mrd. Franken. Damit schreibt die Bank, die mit 68 Mrd. an Steuergeldern gerettet werden musste, zum ersten Mal seit 2006 wieder schwarze Zahlen. Pikant sind die geplanten Bonus-Zahlungen: Sie sollen aus einem Topf erfolgen, der satte 4,3 Mrd. Franken umfasst.
Die Jahresbilanzen der UBS sind nun bekannt: Die UBS machte im Jahr 2010 einen Gewinn von 7,16 Mrd. Franken. Damit schreibt die Bank, die mit 68 Mrd. an Steuergeldern gerettet werden musste, zum ersten Mal seit 2006 wieder schwarze Zahlen. Pikant sind die geplanten Bonus-Zahlungen: Sie sollen aus einem Topf erfolgen, der satte 4,3 Mrd. Franken umfasst. In einer ersten Bilanz wertet das «Wuppertaler Bündnis gegen Nazis» den Protest gegen die Nazikundgebung am vergangenen Samstag als grossen Erfolg. Trotz der Repression der Polizei wurde der Bahnverkehr lahmgelegt, um die Anreise der Nazis zu verhindern. Die Polizei liess die Nazis gewähren. Es kam zu Verletzte und Verhaftungen.
In einer ersten Bilanz wertet das «Wuppertaler Bündnis gegen Nazis» den Protest gegen die Nazikundgebung am vergangenen Samstag als grossen Erfolg. Trotz der Repression der Polizei wurde der Bahnverkehr lahmgelegt, um die Anreise der Nazis zu verhindern. Die Polizei liess die Nazis gewähren. Es kam zu Verletzte und Verhaftungen. Die kapitalistischen Führungskräfte versuchen, die Möglichkeit grundsätzlicher Veränderung nichtig erscheinen zu lassen. Sie klammern sich an ein System, das ihre Profite sichern soll und auf der anderen Seite die negativen Folgen auf einen Grossteil der Menschheit abwälzt: Krieg, Hunger und Klimaveränderung sind drei Beispiele dafür. Die Medienberichtserstattung zum WEF zeigt, dass es nicht ganz einfach ist, das Treffen in Davos als Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme darzustellen. Die örtliche Bevölkerung zweifelt daran, dass das WEF ihnen Vorteile bringt, die immergleichen Inhalte des WEF werden kritisiert und die Teilnehmenden selbst äussern sich über die kulturellen Eigenheiten der Schweiz, anstatt über die «Errungenschaften» des Treffens zu sprechen. Die ökonomische Krise hat sich auf politische und kulturelle Bereiche ausgeweitet. Das WEF-Motto «Gemeinsame Normen für die neue Realität» ist der verzweifelte Ruf nach Gemeinsamkeit, die es aber weder zwischen den einzelnen KapitalistInnen, noch viel weniger zwischen den Klassen geben kann.
Die kapitalistischen Führungskräfte versuchen, die Möglichkeit grundsätzlicher Veränderung nichtig erscheinen zu lassen. Sie klammern sich an ein System, das ihre Profite sichern soll und auf der anderen Seite die negativen Folgen auf einen Grossteil der Menschheit abwälzt: Krieg, Hunger und Klimaveränderung sind drei Beispiele dafür. Die Medienberichtserstattung zum WEF zeigt, dass es nicht ganz einfach ist, das Treffen in Davos als Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme darzustellen. Die örtliche Bevölkerung zweifelt daran, dass das WEF ihnen Vorteile bringt, die immergleichen Inhalte des WEF werden kritisiert und die Teilnehmenden selbst äussern sich über die kulturellen Eigenheiten der Schweiz, anstatt über die «Errungenschaften» des Treffens zu sprechen. Die ökonomische Krise hat sich auf politische und kulturelle Bereiche ausgeweitet. Das WEF-Motto «Gemeinsame Normen für die neue Realität» ist der verzweifelte Ruf nach Gemeinsamkeit, die es aber weder zwischen den einzelnen KapitalistInnen, noch viel weniger zwischen den Klassen geben kann.