Obschon sich das WEF als non-profit organisation bezeichnet, ist es als kapitalistisches Unternehmen zu betrachten, das einen Tauschwert produziert, für den es von den internationalen Konzernen bezahlt wird. Nur schon pro TeilnehmerIn an der Jahrestagung sind das bekanntlich über $ 20’000.–. Dafür muss es einen Gebrauchswert produzieren. Dieser materialisiert sich in der Organisation der Meetings und ihrem Programm sowie in den zur Verfügung gestellten Strukturen, aktuell z.B. die Global Agenda Councils, die Global Redisign Initiative (GRI) und die interaktive Internetplattform WELCOM.
Historisches
Das WEF ist ein unmittelbares Produkt der Anfang der 1970er Jahre ausgebrochenen Kapitalüberproduktionskrise: Es wurde im Januar 1971 durch Klaus Schwab, damals Professor für business policy in Genf, als European Management Forum initiiert und führt seit 1972 die Davoser Jahrestreffen durch. 1987 wurde es zu World Economic Forum umgetauft, dem jetzigen Namen. Zum Gebrauchswert der Tagungen gehören neben dem Programm selbstverständlich die Vernetzungsmöglichkeiten der TeilnehmerInnen in den Hinterzimmern, in denen abgesprochen, Marketing betrieben und gedealt werden kann, und indirekt die Produktion und Reproduktion der kapitalistischen Ideologie.
Als Vorbereitungsausschuss für das Davoser Programm sind über 70 Global Agenda Councils institutionalisiert worden, also Expertengremien, die vom 20.-22.11.2009 zum zweiten Mal in Dubai zusammenkommen sind, abgeschottet von der Bewegung. In bewährter Grossmäuligkeit spricht WEF-Gründer Schwab von über 700 der innovativsten und einflussreichsten Köpfen der Welt, die für die drängendsten Weltprobleme Lösungen aushecken würden . Darunter sind immerhin 29 mit Schweizer Pass aus Administration, Universitäten, NGOs und Konzernen, u.a. Sepp Blatter, Walter Kielholz von der CS u.a..
Zum Programm
Bei den Meetings des WEF als Kind der Krise stehen folgerichtig seit jeher Bemühungen im Zentrum, die kapitalistische Krise in den Griff zu bekommen. Diese wird nicht nur als ökonomische, sondern auch als politische und kulturelle aufgefasst. Das widerspiegelt sich in den eingeladenen Teilnehmerinnen: Ca. 1500 Wirtschaftsführer aus allen Ländern weltweit, gegen 50 Staatschefs und weitere Regierungsmitglieder sowie führende Kulturträger im weitesten Sinn: Bosse der internationalen Medien, Bosse der Universitäten und think-tanks, von NGOs, bekannte Kulturschaffende.
Aus publizierten Texten und den Titeln der Global Agenda Councils kann heraus destilliert werden, wie sie die Krise und die damit verbundenen Hauptprobleme sehen und wie sie Abhilfe schaffen wollen. Im Zentrum steht die Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums und die Kontrolle ausserökonomischer Bedrohungen.
Aufgrund einer marxistischen Krisenanalyse können die Themen klarer geordnet werden:
Es fehlt an profitablen Investitionsmöglichkeiten. Ein Schwerpunkt des Programms bildet deshalb die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten für die Privatwirtschaft durch neue Technologien, Entwicklung von Wirtschaftssektoren wie erneuerbare Energien, Kommunikationstechnologie, Unterhaltungsindustrie, Sport, Stadtentwicklung, Privatisierungen von Wasser, Bildung u.a.
Hauptmechanismus der Krise sind die tendenziell fallenden Profitraten.
Dagegen helfen vor allem entgegenwirkende Ursachen, also: wie kann die Ausbeutung verschärft werden? Themen sind die allgemeine Arbeitsmarktpolitik, Deregulierung „verkrusteter“ Arbeitsmärkte, Sozialabbau, innerbetriebliche Rationalisierungsmassnahmen, Auslagerung der Produktion = Kapitalexport, freier Kapitalverkehr, Investitionsschutz, Migrationspolitik als Arbeitsmarktpolitik, billige Nahrungsmittel zwecks tief Halten der Lohnkosten. Weiter geht es um Verbilligung des konstanten Kapitals, insbesondere der Rohstoffe, Erdöl etc., Erschliessung neuer Rohstoffquellen, Produktivkraftentwicklung im Bau von Maschinen und Infrastruktur etc., Förderung des Welthandels, Bekämpfung des Protektionismus. Erinnert sei an die jährlichen Bemühungen von Deiss und Leuthard zur Deblockierung der Doha-Runde.
Voraussetzung für die Krisenbewältigung ist selbstverständlich die Wiederherstellung des Kreditwesens, also die Reparatur des Finanzsystems, ferner die öffentliche Entschuldung und die Entschuldung der Betriebe und Privatpersonen.
Viel heisse Luft
Die Krise führt zur verschärften Konkurrenz nicht nur zwischen den einzelnen Konzernen, sondern vor allem auch zwischen den Kapitalfraktionen der einzelnen Länder und Regionen, also ihren Standorten. Diese werden durch die jeweiligen Regierungen und Organen regionaler Zusammenschlüsse vertreten. Die zunehmende Konkurrenz verschärft die interimperialistischen Widersprüche, den Protektionismus und die Tendenz zu imperialistischen Kriegen. Nicht zufällig hiess deshalb ein übergreifendes Thema der letzten Jahre Zusammenarbeit unter Konkurrenten; nicht zufällig ruft Schwab unermüdlich zur Zusammenarbeit aller global leaders auf; nicht zufällig versteht sich das WEF seit 1987 als Plattform zur Lösung internationaler Konflikte, indem Konfliktparteien in Davos informell zusammengebracht werden zum Anleiern von Friedensprozessen. Dass es um solche Aktivitäten eher still geworden ist, zeigt eines: Die Lösung internationaler Konflikte wird immer schwieriger; die Einzelinteressen der konkurrierenden Kapitalfraktionen sind meist stärker als das Gesamtinteresse des Kapitals, die Krise zu überwinden. Weder das WEF noch andere internationale Organisationen können Weltregierung spielen und wirksame Pläne zur gemeinsamen Ausbeutung und Unterdrückung aushecken und umsetzen.
Schliesslich können ausserökonomische Ursachen die kapitalistische Ökonomie bedrohen und die Krise verschärfen. Das WEF thematisiert sie als „grosse Herausforderungen der Menschheit“: Naturkatastrophen, Umweltbelastung, insbesondere der Treibhauseffekt, Rohstoffverknappung, Pandemien, aufgebauschte demographische Faktoren wie Zunahme und vor allem Überalterung der Erdbevölkerung. Dabei liegt das Problem nicht in zahlenmässigen Verschiebungen, sondern darin, dass der Kapitalismus nicht in der Lage ist, Arbeit und damit Überleben für alle sicherzustellen, vor allem nicht für die Jungen. Das wird mit der Betonung „demografischer Probleme“ verschleiert.
Neben der äusseren geht es vor allem auch um Innere Sicherheit: Stärkung der Staaten und ihrer Justiz, Antiterrorismus, Schaffung eines gemeinsamen Wertesystems, Wiederherstellung des Vertrauens und sozialpolitische Themen, die auch als Wachstumsmotoren gesehen werden. eingeordnet werden.
Dahinter steht, neben der Krisenbekämpfung, das generelle Problem der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems. Das Proletariat und verarmende Volksschichten müssen durch ökonomische und ideologische Integration und notfalls Repression und Vernichtung niedergehalten werden. Die antikapitalistischen Mobilisierungen gegen das WEF sind daher eine richtige Antwort.
Quelle: aufbau.org
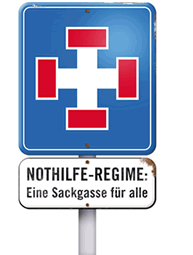 Das Nothilfe-System im Asylwesen muss grundsätzlich in Frage gestellt werden. Zu diesem Zweck startet heute schweizweit eine Kampagne der vier im Asylbereich tätigen Organisationen Amnesty International, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht und Solidarité sans frontières.
Das Nothilfe-System im Asylwesen muss grundsätzlich in Frage gestellt werden. Zu diesem Zweck startet heute schweizweit eine Kampagne der vier im Asylbereich tätigen Organisationen Amnesty International, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht und Solidarité sans frontières.
 Berlin. Am gestrigen Tag löste die berliner Polizei ein weiteres, linksalternatives Wohnprojekt auf. Die Hausbesetzer der Liebigstrasse 14 wehrten sich mit Kräften gegen die anrückende Polizei, konnten die Räumung des Gebäudes aber nicht verhindern. 32 Personen wurden bereits bei der Hausräumung festgenommen, bei einer Demonstration am Abend folgten weitere 82.
Berlin. Am gestrigen Tag löste die berliner Polizei ein weiteres, linksalternatives Wohnprojekt auf. Die Hausbesetzer der Liebigstrasse 14 wehrten sich mit Kräften gegen die anrückende Polizei, konnten die Räumung des Gebäudes aber nicht verhindern. 32 Personen wurden bereits bei der Hausräumung festgenommen, bei einer Demonstration am Abend folgten weitere 82. Detailhandelsangestellte und die Gewerkschaft Unia haben am 1.Februar in Bern gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten protestiert. Der Widerstand zeigte Wirkung: SVP-Grossrat Erich Hess zog seinen Vorstoss zurück.
Detailhandelsangestellte und die Gewerkschaft Unia haben am 1.Februar in Bern gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten protestiert. Der Widerstand zeigte Wirkung: SVP-Grossrat Erich Hess zog seinen Vorstoss zurück. Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung ist ganzjährig einer zu hohen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz fordern griffige Massnahmen.
Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung ist ganzjährig einer zu hohen Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz fordern griffige Massnahmen. Ueli Maurer erklärte bezüglich der Attacke gegen Parteikollege Fehr in der Zeitung «Sonntag»: «In einem solchen Fall müsste innerhalb von 24 Stunden ein Schuldspruch fallen und die Strafe innerhalb von zwei Tagen ausgesprochen werden.» Maurer erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung: «Es gibt in diesen Szenen oft Mitläufer. Wenn diese am Montag nicht am Arbeitsplatz erscheinen, haben sie ein Problem. Man muss den gewaltbereiten Kern der Szene isolieren und die Mitläufer, die den Kern schützen, davon trennen können.» Bereits vor einiger Zeit hat er Schnellgerichte gegen Hooligans gefordert. Nun präzisiert er den Kreis der Delikte: Schnellgerichte sollen zum Einsatz kommen bei «Sachbeschädigung, Missbrauch von Eigentum, Vermummung, Gewalt gegen Leib und Leben.»
Ueli Maurer erklärte bezüglich der Attacke gegen Parteikollege Fehr in der Zeitung «Sonntag»: «In einem solchen Fall müsste innerhalb von 24 Stunden ein Schuldspruch fallen und die Strafe innerhalb von zwei Tagen ausgesprochen werden.» Maurer erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung: «Es gibt in diesen Szenen oft Mitläufer. Wenn diese am Montag nicht am Arbeitsplatz erscheinen, haben sie ein Problem. Man muss den gewaltbereiten Kern der Szene isolieren und die Mitläufer, die den Kern schützen, davon trennen können.» Bereits vor einiger Zeit hat er Schnellgerichte gegen Hooligans gefordert. Nun präzisiert er den Kreis der Delikte: Schnellgerichte sollen zum Einsatz kommen bei «Sachbeschädigung, Missbrauch von Eigentum, Vermummung, Gewalt gegen Leib und Leben.» Bereits am 27. Januar war die Metallindustrie der Emilia-Romagna mit einem Streik lahm gelegt worden. In Bologna hatten sich Tausende zu einer Kundgebung versammelten. Am Freitag, 28. Januar sind tausende von DemonstrantInnen auch in Turin und Mailand auf die Strasse, um gegen das Abkommen zu protestieren, das Fiat mit einigen sozialpartnerschaftlich orientierten Gewerkschaften abgeschlossen hat. In einem Referendum hatte die Belegschaft des Turiner Stammwerkes Mirafiori vor zwei Wochen mit einer knappen Mehrheit für die Annahme gestimmt. 80 Prozent der Beschäftigten dieses Werkes waren beim Streik dabei. Bei Iveco, dem LKW-Werk von Fiat liegt die Streikbeteiligung bei 70 Prozent. «Wir protestieren gegen ein schändliches Abkommen, das die Rechte der ArbeiterInnen beschneidet», betonen die Arbeiter, die sich an der großen Demonstration in Turin beteiligen. Einige Demonstranten tragen Masken mit den Gesichtern von Fiat-Chef Marchionne und Regierungschef Silvio Berlusconi. Angeführt wurde die Demonstration vom Nationalen Sekretär der Gewerkschaft Fiom, Maurizio Landini. Er sagte angesichts der grossen Beteiligung, dass es jetzt an der Zeit sei, den allgemeinen Generalstreik zu wagen. Paolo Ferrero, Nationaler Sekretär von Partito della Rifondazione Comunista, der ebenfalls an der Demonstration in Turin teilnahm gab zu Protokoll: «Die ArbeiterInnen haben zunehmend bemerkt, dass der Angriff von Marchionne alle angeht, und haben jetzt eine Generalantwort gegeben. Sie rufen nach dem Generalstreik.»
Bereits am 27. Januar war die Metallindustrie der Emilia-Romagna mit einem Streik lahm gelegt worden. In Bologna hatten sich Tausende zu einer Kundgebung versammelten. Am Freitag, 28. Januar sind tausende von DemonstrantInnen auch in Turin und Mailand auf die Strasse, um gegen das Abkommen zu protestieren, das Fiat mit einigen sozialpartnerschaftlich orientierten Gewerkschaften abgeschlossen hat. In einem Referendum hatte die Belegschaft des Turiner Stammwerkes Mirafiori vor zwei Wochen mit einer knappen Mehrheit für die Annahme gestimmt. 80 Prozent der Beschäftigten dieses Werkes waren beim Streik dabei. Bei Iveco, dem LKW-Werk von Fiat liegt die Streikbeteiligung bei 70 Prozent. «Wir protestieren gegen ein schändliches Abkommen, das die Rechte der ArbeiterInnen beschneidet», betonen die Arbeiter, die sich an der großen Demonstration in Turin beteiligen. Einige Demonstranten tragen Masken mit den Gesichtern von Fiat-Chef Marchionne und Regierungschef Silvio Berlusconi. Angeführt wurde die Demonstration vom Nationalen Sekretär der Gewerkschaft Fiom, Maurizio Landini. Er sagte angesichts der grossen Beteiligung, dass es jetzt an der Zeit sei, den allgemeinen Generalstreik zu wagen. Paolo Ferrero, Nationaler Sekretär von Partito della Rifondazione Comunista, der ebenfalls an der Demonstration in Turin teilnahm gab zu Protokoll: «Die ArbeiterInnen haben zunehmend bemerkt, dass der Angriff von Marchionne alle angeht, und haben jetzt eine Generalantwort gegeben. Sie rufen nach dem Generalstreik.»
 Die Delegierten haben dabei untere anderem die Lohnverhandlungen bilanziert. Im Durchschnitt können die Arbeitnehmendem 2011 mit real rund einem Prozent mehr Lohn rechnen. Dies ist gerade noch akzeptabel. Inakzeptabel ist hingegen, dass diese Lohnerhöhung durch höhere Abgaben sowie durch steigende Krankenkassenprämien wieder weggefressen werden. Die von vielen Kantonen angekündigten Sparprogramme stellen zudem wichtige öffentliche Leistungen in Frage. Es droht eine weitere Verlagerung zu höheren Gebühren und Krankenkassenprämien. Beides führt zu einer Schwächung der Kaufkraft der Arbeitnehmenden. Bund, Gemeinden und Kantone müssen auf Sparmassnahmen verzichten, welche die Kaufkraft schwächen. Statt die Einnahmen mit einem ruinösen Steuerwettbewerb zu senken, sollen vielmehr die hohen Einkommen, die auch während der Krise ihr Vermögen weiter steigern konnten, einen Beitrag leisten.
Die Delegierten haben dabei untere anderem die Lohnverhandlungen bilanziert. Im Durchschnitt können die Arbeitnehmendem 2011 mit real rund einem Prozent mehr Lohn rechnen. Dies ist gerade noch akzeptabel. Inakzeptabel ist hingegen, dass diese Lohnerhöhung durch höhere Abgaben sowie durch steigende Krankenkassenprämien wieder weggefressen werden. Die von vielen Kantonen angekündigten Sparprogramme stellen zudem wichtige öffentliche Leistungen in Frage. Es droht eine weitere Verlagerung zu höheren Gebühren und Krankenkassenprämien. Beides führt zu einer Schwächung der Kaufkraft der Arbeitnehmenden. Bund, Gemeinden und Kantone müssen auf Sparmassnahmen verzichten, welche die Kaufkraft schwächen. Statt die Einnahmen mit einem ruinösen Steuerwettbewerb zu senken, sollen vielmehr die hohen Einkommen, die auch während der Krise ihr Vermögen weiter steigern konnten, einen Beitrag leisten. Wie «Schweiz aktuell» berichtet verpflegt beispielsweise das Hotel Steigenberger pro Tag etwa 1000 Gäste. Da gibt es hunderte Kilos Rüstabfälle. Zahllose Teller kommen nur halb aufgegessen zurück. Fast unberührte Buffets müssen wieder abgetragen werden. Dazu gibt es auch in der Küche Überproduktionen.
Wie «Schweiz aktuell» berichtet verpflegt beispielsweise das Hotel Steigenberger pro Tag etwa 1000 Gäste. Da gibt es hunderte Kilos Rüstabfälle. Zahllose Teller kommen nur halb aufgegessen zurück. Fast unberührte Buffets müssen wieder abgetragen werden. Dazu gibt es auch in der Küche Überproduktionen.