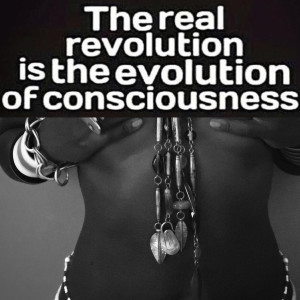Wir wollen keinen Sitz an einem kaputten Tisch!
 Lily Zheng. In den USA sollen Transmenschen offen im Militär dienen «dürfen». Eine Kritik an der Mainstream-LGBT-Bewegung und was diese als Erfolg bezeichnet.
Lily Zheng. In den USA sollen Transmenschen offen im Militär dienen «dürfen». Eine Kritik an der Mainstream-LGBT-Bewegung und was diese als Erfolg bezeichnet.
Transgender Menschen in den USA haben viele Erfahrungen damit, von der Mainstream-LGBT-Bewegung ignoriert zu werden. Diese Bewegung, die auch aus den Kämpfen von TransaktivistInnen in den 60er-Jahren hervorging und schnell von weissen Schwulen und Lesben aus der Mittel- und Oberschicht vereinnahmt wurde, hat sich auf Assimilierung, Ehe und Normalität, nicht aber auf Gerechtigkeit konzentriert.
Nachdem das Oberste Gericht der USA im Juni 2015 zugunsten der Legalisierung der Homoehe entschieden hat, hat diese Bewegung ihr nächstes Ziel gefunden: Transgender-Rechte. Aber was für Rechte sind damit gemeint? Die «Transgender-Rechte», die die Mainstream-LGBT-Bewegung fordert – etwa die Intergration von transgender Armeeangehörigen – gerhören derselben assimilierenden Rhetorik an, die zu den anderen Erfolgen geführt hat.
Assimilation für die Privilegierten
Die Politik von «Don’t Ask, Don’t Tell», die es schwulen, lesbischen und bisexuellen Armeeangehörige verboten hat, geoutet im Militär zu dienen, wurde 2011 aufgehoben. In diesem Entscheid waren nur drei der vier Buchstaben der Abkürzung LGBT eingeschlossen, transgender SoldatInnen blieben zurück. Man schätzt, dass sich gegenwärtig 15 500 transgender Personen im Aktivdienst oder in den Reserveeinheiten befinden. Diese Personen sehen sich zahlreichen Schwierigkeiten gegenüber aufgrund der restriktiven und unzeitgemässen Richtlinien, die die Auslebung ihrer Identität einschränken: Die Drohung der unehrenhaften Entlassung, wenn sie ihre Transidentität bekannt machen; das Verbot, eine ihrem Geschlecht entsprechende Uniform zu tragen und mit dem Namen und den Pronomen ihrer Wahl angesprochen zu werden; potenzielle Belästigung und Diskriminierung wegen ihrer Genderidentität. Die Gesetzeslage zu aktualisieren, um Transmenschen zu ermöglichen, offen der Armee beizutreten, würde ihr Leben erleichtern und die Effektivität der Armee erhöhen – so lautet die Argumentation der Mainstream-LGBT-Bewegung.
Es ist eine Taktik, die die Mainstream-LGBT-Bewegung mit Erfolg angewendet hat: Sich für die Integration in die angesehensten Institutionen der Gesellschaft einzusetzen, ob Ehe oder Militär. Diese Taktik beruht darauf, «Normalität» vorzuschützen und zu beweisen, dass LGBT-Menschen genauso sind wie alle anderen. Sie beruht letztlich darauf, die privilegierten (die wohlhabenden, weissen und cisgender) Lesben und Schwulen zu assimilieren, damit sie die gleichen gesellschaftlichen Vorteile geniessen können wie ihre gleichermassen privilegierten Hetero-FreundInnen.
Mitschuldig an der globalen Ungerechtigkeit
US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat die Bildung einer Arbeitsgruppe angeordnet, um herauszufinden, ob die Integration von Transmenschen einen «negativen Effekt auf die Effektivität und Bereitschaft der Armee» hat. Wir wissen bereits, zu welchem Schluss die Arbeitsgruppe kommen wird: Transgender SoldatInnen können genauso wie alle anderen eine Waffe bedienen. Transgender SoldatInnen können genauso wie alle anderen Befehle folgen. Transgender SoldatInnen können genauso wie alle anderen im Namen des Staates Mord begehen.
Als eine nicht-weisse Transfrau finde ich es besonders ironisch, dass ich bald die Möglichkeit hätte, einem Land zu dienen, dass meine schwarzen und braunen Schwestern auf den Strassen, in den Gefängnissen und in anderen Ländern misshandelt und tötet. Ich finde es ironisch, dass dies für die Mainstream-LGBT-Bewegung ein Sieg darstellt. Das Recht, sich an der US-Kriegsmaschine zu beteiligen, hilft uns Transmenschen nicht. Die Assimilation in ein unterdrückerisches System, das die fortwährende Besetzung von anderen Ländern antreibt, den sogenannten Krieg gegen den Terror, der die Menschen im Mittleren Osten terrorisiert und im eigenen Land Islamophobie fördert, sowie die Assimilation in einen aggressiven Neoliberalismus, der die Armee als Werkzeug für die Ausdehnung des ökonomischen Gewinns benutzt, ist kein Sieg. Keine Rhetorik, die inhaltsleer Patriotismus und Nationalismus im Namen der Transmenschen wiederholt, kann die Tatsache beseitigen, dass das US-Militär mitschuldig ist an der globalen Ungerechtigkeit.
Die wirkliche Arbeit liegt woanders
Intergrationskampagnen helfen denjenigen nicht, die bereits systematisch von der Gesellschaft aufgrund ihrer Identität ausgeschlossen werden. Für nicht-weisse Transmenschen, Transfrauen, behinderte und neurodiverse Transmenschen, nicht-binäre Transmenschen und viele andere ist die Integration ins Militär kein relevantes Thema.
Das bedeutet nicht, dass ich dagegen eintreten möchte – mit aller Wahrscheinlichkeit wird es durchgesetzt werden. Aber wirkliche Erfolge bestehen nicht daraus, einen Sitz an einem bereits kaputten Tisch zu besetzen, sondern daraus, das unterdrückende System zu überwinden und wirkliche Alternativen aufzubauen. Echte Erfolge bestehen nicht aus Pinkwashing, sondern aus einem bezahlbaren Gesundheitssystem und sicheren Wohnraum, im Stopp von Deportationen, von Kriminalisierung und Polizeibrutalität. Die übliche Antwort darauf ist immer eine Variation von «Das kommt als nächstes» oder «Eins nach dem anderen». Davon sind wir Transmenschen nie überrascht. Während sich TransaktivistInnen für die genannten Forderungen, die ihren Gemeinschaften wirklich helfen, eingesetzt haben, hat sich die Mainstream-LGBT-Bewegung abgemüht, Themen zu finden, die nichts mit Befreiung zu tun haben – von Befreiung können reiche weisse queere Männer und Frauen und ihre WirtschaftssponsorInnen nicht profitieren. Es macht Sinn, dass eine Bewegung, die sich nicht für arme, nicht-weisse Trans- und queere Menschen interessiert, sondern dafür, dass eine Biermarke oder eine Bank ihre Gayprides sponsert, nach Ablenkungen sucht. Die Integration von Transmenschen ins Militär ist bestenfalls eine solche Ablenkung. Natürlich wird es transgender SoldatInnen helfen, ein Leben mit etwas weniger Angst und Unannehmlichkeiten zu führen, das ist positiv. Aber die wirkliche Arbeit liegt woanders: anständige Löhne, bezahlbares Gesundheitssystem und Wohnraum, Black Lives Matter, Gefängnisarbeit.