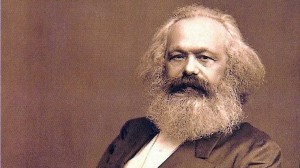Ein Nein ohne Wenn und Aber!
Für die Partei der Arbeit der Schweiz (PdAS) kann die Unternehmenssteuerreform III (USR III) nicht losgelöst von der vorhergehenden Reform, die USR II, beurteilt werden. Daher ist ein kurzer Blick zurück zwingend: Am 24. Februar 2008 scheiterte das Referendum gegen die USR II mit 49.5 Prozent Nein-Stimmen denkbar knapp, 20’000 Stimmen gaben den Ausschlag. Im Abstimmungsbüchlein des Bundesrates zu dieser Volksabstimmung wurden die Steuerausfälle auf höchstens 933 Millionen Franken beziffert. Drei Jahre später, am 14. März 2011, musste der Bundesrat auf Druck des Parlaments jedoch zugeben, dass Bund, Kantone und Gemeinden wegen der USR II mit Steuerausfällen von über 7 Milliarden Franken in den nächsten 10 Jahren rechnen müssen. Steuerausfälle, die «tendenziell ansteigen und nicht zurückgehen» werden, wie Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf im Juni 2011 im Ständerat erklärte (Amtliches Bulletin vom 9. Juni 2011). Der Bundesrat hatte das Volk vor der Abstimmung schlicht angelogen! Das sieht auch das Bundesgericht so: Die Nationalräte Margret Kiener Nellen und Daniel Jositsch reichten eine Beschwerde ein und forderten eine Wiederholung der Abstimmung. Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde ab. Jedoch ist im Urteil vom 20. Dezember 2011 zu lesen, dass der Bundesrat die «Stimmbürger hinters Licht geführt» hat.
Zur USR III
Nach diesem Betrug am Volk soll nun die aktuelle Reform zu Steuerausfällten von mindestens 2.2 Milliarden führen. Es ist dies ein erneutes Geschenk an die Grossunternehmen im Lande. Wir lehnen die USR III kategorisch ab, weil sie zu einer massiven Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen in der Schweiz führen wird. Die beweist die Praxis und die Realität der letzten Jahre: Die Steuergeschenke an die Unternehmen durch die letzte Reform, die USR II aus dem Jahr 2008, wurden mit einem massiven Sozialabbau finanziert. Besonders zu nennen sind dabei die «Reformen» der Arbeitslosen- sowie der Invalidenversicherung, der Abbau im Bildungswesen und im öffentlichen Dienst. Dies wird bei der USR III nicht anders sein, davon ist die PdAS überzeugt.
Wir lehnen daher sämtliche vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen ab, wobei wir zwei besonders erwähnen:
– Lizenzboxen
Selbst in den veröffentlichten Unterlagen des Bundesrats ist zu lesen, dass die Einführung der Lizenzboxen «verfassungsrechtlich problematisch sei». Dies, weil die Schweizer Verfassung eine Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vorschreibt. Bei der Einführung der Lizenzboxen wäre dies nicht mehr der Fall, da zum Beispiel Chemiefirmen mit vielen Lizenzen steuerlich bevorteilt würden gegenüber etwa Dienstleistungsunternehmen ohne Patente. Es ist bedenklich, dass der Bundesrat wissentlich den Verstoss gegen die Verfassung in Kauf nimmt, um die Interessen der Grossunternehmen zu befriedigen.
– Kapitalgewinnsteuer
Die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer, die laut Bundesrat etwa 300 Millionen Franken einbringen würde, ist eine alte Forderung der PdAS. Die Steuer darf jedoch nicht als Massnahme eingeführt werden, um die geplanten Steuerausfälle etwas zu lindern. Sie muss vielmehr mit dem Ziel und Zweck eingeführt werden, dass sie Mehreinnahmen generiert, die zur Finanzierung und dem Ausbau der Sozialversicherungen führen.
Forderungen der PdAS
In diesem Sinne sind auch die folgenden steuerpolitischen Forderungen der PdAS zu verstehen:
– Erhöhung der Gewinnsteuer bei Kapitalgesellschaften
– Radikale Erhöhung der Grundstückgewinnsteuer
– Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen
– Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer
– Harmonisierung der Steuersätze von Gemeinden und Kantonen
– Erhöhung der Steuern der Grossvermögen
Schlussbemerkung
Die PdAS wird jede Vorlage mit dem Referendum entschieden und entschlossen bekämpfen, die Steuerausfälle, sprich Steuergeschenke für die Unternehmen, vorsehen wird.
Partei der Arbeit der Schweiz
Weitere Infos zur USRIII: 2.2 Milliarden pro Jahr! Und die Linke?