 Seit Ende April kämpfen die ArbeiterInnen von Merck Serono in Genf um ihre Arbeitsplätze und ihre Würde. Einige hundert Meter entfernt vom Lac Lemon und flankiert von verschiedenen internationalen Organisationen, radikalisiert sich eine Belegschaft von ForscherInnen durch ihren Kampf.
Seit Ende April kämpfen die ArbeiterInnen von Merck Serono in Genf um ihre Arbeitsplätze und ihre Würde. Einige hundert Meter entfernt vom Lac Lemon und flankiert von verschiedenen internationalen Organisationen, radikalisiert sich eine Belegschaft von ForscherInnen durch ihren Kampf.
In einem Kurzvideo hat eine Arbeiterin von Merck Serono den bisherigen Verlauf des Kampfes zusammengefasst. Unter dem Titel «Site closure Merck Serono Geneva» flimmern Bilder vom Widerstand gegen den Abbau der 1?250 Arbeitsplätze in Genf über die Leinwand: Flashmobs, Demonstrationen, Bilder vom Streik. Die rund 400 ArbeiterInnen in der Halle Sécheron geben dem Film einen langen Applaus. Kurz darauf wird die Versammlung erneut für Streik stimmen. Eine Strassenblockade wird vorgeschlagen. Einem Aufruf zum Hungerstreik schliessen sich spontan zehn Leute an. Innerhalb von zwei Monaten hat sich eine Belegschaft radikalisiert, die mit Klassenkampf bis anhin nichts am Hut hatte.
Radikalisierung der Belegschaft
Dabei reagierte Merck mit der Schliessung des Genfer Standortes auf die mörderische Konkurrenz in der Pharma- und Chemiebranche. Mit der Strategie «Fit for 2018» sollen Kosten in der auf langfristiges Engagement angelegten Forschung reduziert werden. Da mit dem Hauptsitz in Darmstadt bereits eine kleine, flexible und dynamische Forschungseinheit existiert, wollte der Konzern mit der Aufhebung von Merck Serono Genf Doppelspurigkeiten abbauen. Da die Belegschaft an den zwanglosen Zwang des besseren Arguments in der Auseinandersetzung glaubte, arbeiteten Arbeitsgruppen in der Konsultationsphase drei Lösungsvorschläge aus, um die Arbeitsplätze in Genf zu behalten. Selbst die liberale «Neue Zürcher Zeitung» zeigte sich von den Vorschlägen tief beeindruckt. Statt rüdem Gewerkschaftston finde man hier handfeste Argumente. Die Verantwortlichen hätten den Stab wohl vorschnell über dem Genfer Betrieb gebrochen. Doch sowohl die NZZ als auch die ArbeiterInnen verkannten bis zu diesem Zeitpunkt, dass im Klassenkampf nicht die Argumente, sondern das Kräfteverhältnis entscheidend ist. Am 19. Juni verwarf Merck alle drei Vorschläge in Bausch und Bogen.
Aus diesem Rückschlag sollte die Belegschaft ihre Lehren ziehen. Waren die Aktionen zu Anfang sehr kreativ, so wurden sie nun zunehmend radikaler. Überhaupt lässt sich an der Radikalisierung der ArbeiterInnen von Merck Serono wunderbar aufzeigen, wie sich das Bewusstsein von Menschen durch Kämpfe verändern kann. Von den 1?250 ArbeiterInnen im Genfer Standort haben 750 einen akademischen Titel oder sind Marketingfachleute. Noch vor einem halben Jahr konnten sich nur wenige vorstellen, an einer Demonstration teilzunehmen. Es gab nicht einmal eine gewerkschaftliche Vertretung im Betrieb. Im Schnelldurchgang spielten die ArbeiterInnen alle sozialpartnerschaftlichen und symbolischen Mittel durch: Mit einer Petition kamen innerhalb von kurzer Zeit 12?000 Unterschriften zur Erhaltung der Arbeitsplätze zusammen. Zugleich wurden Flashmobs und Demonstrationen durchgeführt. Einige ArbeiterInnen bestiegen sogar einen Berg, um ein Transparent gegen die Schliessung in die Höhe zu halten. Doch erst die Androhung ökonomischen Drucks mittels Streik erwirkte die Verlängerung der Konsultationsphase.
Nachdem die Vorschläge aus der Konsultationsphase schlichtweg abgelehnt wurden, machte die Belegschaft ihre Drohung wahr und trat in den Streik. Der Streik vom 20. und 21. Juni spielte sich hauptsächlich auf dem Vorplatz des gläsernen Haupteingangs ab. Aus Angst vor einer Besetzung des Betriebs engagierte das Unternehmen eine Heerschar von Securitas-Angestellten, die das Geschehen vor den Glastüren grimmig begutachteten. Ein Fotograf machte präventiv Aufnahmen von streikenden ArbeiterInnen. Die Streikenden erbauten auf dem Gehsteig vor dem Betrieb eine kleine Zeltstadt und nannten sie «Occupy Merck Serono». Die Polizei liess sie dabei trotz Wegweisungsbefehl gewähren. Doch die Teilnahme am Streik war bereits am zweiten Tag rückläufig. Nach neun Wochen Kampf begannen sich bei den ArbeiterInnen erste Ermüdungserscheinungen zu zeigen. An der Vollversammlung vom Donnerstag wurde beschlossen, den Streik auszusetzen und den PolitikerInnen die Chance zu geben, Merck an den Verhandlungstisch zu zwingen.
Auf dem Weg zur internationalen Bewegung
Das Rationalisierungsprogramm «Fit for 2018» betrifft nicht nur den Standort Genf. Und weil Merck ein internationales Unternehmen ist, haben die ArbeiterInnen Kontakt zu den verschiedenen Sitzen, die auch vom Abbau betroffen sind. Eine Delegation war zudem nach Darmstadt in den Hauptsitz gereist und hatte um Unterstützung gefragt. Trotz anfänglicher Zusage zu einer parallelen Aktion, zog sich der Betriebsrat aus Deutschland hinter die Interessen seines Standorts zurück. Er wolle die Verhandlungen mit dem Unternehmen nicht gefährden. An einem internationalen Aktionstag kamen Solidaritätsbotschaften von verschiedenen Merck-Standorten in Frankreich, Italien und Deutschland. Die Bewegung begann eine internationale Dynamik anzunehmen. Tiefen Eindruck hinterliess die Entdeckung eines Kampfes im Jahre 2010 bei Merck Pakistan. Merck ignorierte den Hungerstreik eines Arbeiters so lange, bis er starb. Entdeckungen wie diese trugen dazu bei, dass die Belegschaft am 28. Juni erneut in Streik trat, dieses Mal begleitet von einem Hungerstreik. Der Kampf wurde zu einer Frage der Würde. Oder wie es ein Arbeiter ausdrückte: «Wir sind keine Möbel, die man einfach so rumschieben kann.»
Zurück in den Fängen der Sozialpartnerschaft
Auf diese weitere Eskalation reagierte die Genfer Regierung plötzlich schnell. Sie schöpfte alle ihre rechtlichen Mittel aus und zwang Merck, mit VertreterInnen der Belegschaft, der Gewerkschaft und der Regierung an einen Tisch zu sitzen. Das ist aber auch schon das einzig Positive an dieser Mediation. Denn Merck ist zu nichts verpflichtet, ausser an den Sitzungen teilzunehmen. Diese können maximal 45 Tage dauern und drehen sich nur um den Sozialplan. Der Erhalt der Arbeitsplätze wird nicht diskutiert. Während dieser Zeit ist es den ArbeiterInnen verboten, Kampfmassnahmen zu ergreifen, zu Demonstrationen aufzurufen oder Communiqués rauszugeben. Damit wurde den ArbeiterInnen der Wind aus den Segeln genommen und eine weitere Zuspitzung des Konflikts verhindert. Doch wer den Erfindungsreichtum und die Ausdauer der Belegschaft von Merck Serono kennen gelernt hat, weiss, dass sie immer für eine Überraschung gut ist.

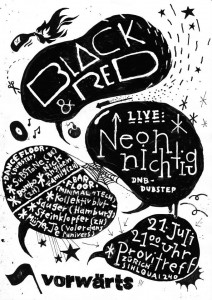
 Seit Ende April kämpfen die ArbeiterInnen von Merck Serono in Genf um ihre Arbeitsplätze und ihre Würde. Einige hundert Meter entfernt vom Lac Lemon und flankiert von verschiedenen internationalen Organisationen, radikalisiert sich eine Belegschaft von ForscherInnen durch ihren Kampf.
Seit Ende April kämpfen die ArbeiterInnen von Merck Serono in Genf um ihre Arbeitsplätze und ihre Würde. Einige hundert Meter entfernt vom Lac Lemon und flankiert von verschiedenen internationalen Organisationen, radikalisiert sich eine Belegschaft von ForscherInnen durch ihren Kampf. Die strikte Unterteilung in «Schweizer seit Geburt» und «Eingebürgerte» war die Forderung eines Vorstosses der SVP im Zürcher Kantonsrat. Dies ist nur die konsequente Fortsetzung einer rassistischen Politik, die in ihrer Logik nicht mehr weit von der völkischen Ideologie entfernt ist.
Die strikte Unterteilung in «Schweizer seit Geburt» und «Eingebürgerte» war die Forderung eines Vorstosses der SVP im Zürcher Kantonsrat. Dies ist nur die konsequente Fortsetzung einer rassistischen Politik, die in ihrer Logik nicht mehr weit von der völkischen Ideologie entfernt ist. Der Bundesrat hat am Mittwoch, 4. Juli entschieden, Waffenexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vorläufig zu stoppen. Für die GSoA ist dieser Entscheid eine reine Alibiübung. Die Vergangenheit zeigt, dass schon in wenigen Wochen der verhängte Lieferstopp wieder aufgehoben wird. Nur ein komplettes Exportverbot von Kriegsmaterial stellt sicher, dass Waffen nicht in einem bewaffneten Konflikt verwendet werden.
Der Bundesrat hat am Mittwoch, 4. Juli entschieden, Waffenexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) vorläufig zu stoppen. Für die GSoA ist dieser Entscheid eine reine Alibiübung. Die Vergangenheit zeigt, dass schon in wenigen Wochen der verhängte Lieferstopp wieder aufgehoben wird. Nur ein komplettes Exportverbot von Kriegsmaterial stellt sicher, dass Waffen nicht in einem bewaffneten Konflikt verwendet werden.  Die Gewerkschaft Unial führt am 3. Juli eine öffentliche Fachtagung zu den Arbeitsbedingungen im Detailhandel durch. Dabei stand die Situation der Verkäuferinnen und Verkäufer im Zentrum.
Die Gewerkschaft Unial führt am 3. Juli eine öffentliche Fachtagung zu den Arbeitsbedingungen im Detailhandel durch. Dabei stand die Situation der Verkäuferinnen und Verkäufer im Zentrum. Nach der ersten Enttäuschungswelle über den Rio+20-Gipfel läuft die Suche nach den Ursachen des Scheiterns. «Die Ergebnisse verdeutlichen, wie gegenläufig die Prioritäten der reichen und armen Länder sind», so das Urteil von Philip Campbell, Chefredakteur der Zeitschrift »Nature». Am besten zeige die Stadt Rio de Janeiro selbst diesen Missstand: Villen und Luxusstrände findet man hier Tür an Tür mit Favelas-Elendsvierteln. Dieser auch globale Kontrast sei schuld am Ausbleiben von Mut und Verbindlichkeit.
Nach der ersten Enttäuschungswelle über den Rio+20-Gipfel läuft die Suche nach den Ursachen des Scheiterns. «Die Ergebnisse verdeutlichen, wie gegenläufig die Prioritäten der reichen und armen Länder sind», so das Urteil von Philip Campbell, Chefredakteur der Zeitschrift »Nature». Am besten zeige die Stadt Rio de Janeiro selbst diesen Missstand: Villen und Luxusstrände findet man hier Tür an Tür mit Favelas-Elendsvierteln. Dieser auch globale Kontrast sei schuld am Ausbleiben von Mut und Verbindlichkeit.  Die US-Medizinaltechnikfirma Greatbatch Medical will einen grossen Teil ihrer Produktion in den Gemeinden Orvin und Corgémont (Berner Jura) nach Mexiko und in die USA auslagern. Der «Vorschlag», wie Mauricio Arellano, Präsident der Medizinischen Greatbatch die Massenentlassung nennt, wird 180 ArbeiterInnen den Job kosten. Die Gewerkschaft Unia hat ein «Treffen mit den Führungsverantwortlichen» angekündigt.
Die US-Medizinaltechnikfirma Greatbatch Medical will einen grossen Teil ihrer Produktion in den Gemeinden Orvin und Corgémont (Berner Jura) nach Mexiko und in die USA auslagern. Der «Vorschlag», wie Mauricio Arellano, Präsident der Medizinischen Greatbatch die Massenentlassung nennt, wird 180 ArbeiterInnen den Job kosten. Die Gewerkschaft Unia hat ein «Treffen mit den Führungsverantwortlichen» angekündigt. Von Brüssel über die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich bis nach Strasbourg, wo am 2. Juli die Abschlussdemo stattfand, wanderten 150 Sans-Papiers während eines Monats durch Europa. Vom 21. Juni bis 25. Juni gastierte der Marsch auch in der Schweiz. In Basel, Bern, Wünnewil und Chiasso wurden kritische Akzente gegen Schengen und die repressive Migrationspolitik gesetzt.
Von Brüssel über die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich bis nach Strasbourg, wo am 2. Juli die Abschlussdemo stattfand, wanderten 150 Sans-Papiers während eines Monats durch Europa. Vom 21. Juni bis 25. Juni gastierte der Marsch auch in der Schweiz. In Basel, Bern, Wünnewil und Chiasso wurden kritische Akzente gegen Schengen und die repressive Migrationspolitik gesetzt.