Türkei: Die Revolution ist endlich da!
 Maria lebt in Istanbul und hat dem vorwärts folgenden Augenzeugenbericht zugestellt.
Maria lebt in Istanbul und hat dem vorwärts folgenden Augenzeugenbericht zugestellt.
Wir sind seit gestern Abend (2.Juni) wieder hier auf der europäischen Seite. Gestern gab es wieder eine «Schlacht» in Besiktas, neben Erdogans Amtssitz. Es war wieder eine sehr brutale Angelegenheit und die Polizei hat sogar mit Gaspistolen in Wohnungen und in die Bahcesehir Universität geschossen. Ständig gab es Nachrichten auf facebook und Twitter, dass Erste Hilfe benötigt wird.
Wir waren im Gezi Park und dort hätte die Stimmung nicht friedlicher sein können. Alle sitzen dort, lassen Ballons steigen, singen, tanzen, reden. Es gibt eigentlich nur ein Thema. Der Protest. Wer war wo an welchem Tag. Wer nimmt was wie wahr, wie fühlt man sich mit all dem?
Ein Freund meines Mannes, mit dem ich mich vor einer Woche darüber unterhalten hatte, dass Leute auf die Strasse gehen müssten, statt ihr ein Leben im Ausland zu planen, rief: «Maria, you told me last week that this is possible! I didn’t believe it and now it happened!» Er ist übrigens einer derer, die seit zwei Tagen an vorderster Front standen und von dem Wasserstrahl umgeworfen wurde, auch diverse Stiefeltritte hat er abbekommen. Aber sein ganzes Gesicht strahlte, als er mir gestern sagte, dass er glücklich ist, dass «die Revolution nun endlich da ist.»
Gegen 1.30 Uhr ging langsam das Gerücht rum, dass die Polizei auf dem Weg zum Park ist. Ein Mann ging rum, um jedem seine Blutgruppe mit Edding auf den Arm zu schreiben, damit die Ärzte schneller Bescheid wissen, falls was passiert. Es gab Aufrufe, die Barrikaden noch ein bisschen höher oder breiter zu bauen und viele Leute sammelten alles was nicht niet und nagelfest ist von der Baustelle und brachten es zu den Barrikaden. Ich stellte mich dann an den Ausgang zum Park, der in Richtung der Wohnung meiner Freundin führt, nur für den Fall, dass man schnell raus muss.
Einer sagte: «Leute, es ist zu gefährlich, hier neben der Baustelle zu stehen. Lasst uns in den Park gehen, damit wir andere Fluchtwege haben und nicht in die Baustelle fallen.» Also zogen sich alle in den Park zurück. Doch nichts passierte. Eine Stunde war Warten angesagt. Dann entspannte sich die Situation wieder und viele kamen zurück auf die Strasse. Die Barrikaden haben gehalten! Es gibt keine Möglichkeit mehr für die Polizei, mit ihren Wasserwerfern in den Park zu gelangen! Was für ein Erfolg!
Allerdings gibt es heut auch schlechte Nachrichten. Die Verhafteten werden scheinbar dazu gezwungen ein Formular zu unterschreiben, das besagt, sie werden von ihrem Recht jemanden anzurufen nicht Gebrauch machen. Erdogan spricht davon, dass jene 50 Prozent der BürgerInnen, die ihn gewählt haben, gegen die DemonstrantInnen kämpfen wollen und er sie nicht mehr lange zurückhalten kann… Und vorsichtshalber, bevor es hier richtig brenzlig werden könnte, ist er für vier Tage nach Afrika abgereist…
3.Juni
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wundervoll es ist, diese grenzenlose Solidarität hier zu erleben. Dies ist eine Protestbewegung, die sich durch wirklich ALLE sozialen Schichten zieht. Ich habe ja schon erzählt, dass alle jeden mit Milch und Zitronen versorgen. Aber das ist wirklich nicht alles. Zum Beispiel gab es eine Situation, als mein Mann, zusammen mit vielen anderen vorgestern vom Taksim Platz in eine Seitenstrasse stürmte, um einer Gasattacke zu entgehen und wirklich jede Tür summte, die gesamte ssentlang, weil Menschen in den Häusern die Türöffner drückten, um die Flüchtenden hereinzulassen. Und nicht nur die Haustüren waren offen, auch alle Wohnungstüren waren offen. Die Menschen gaben Wasser, ihre Sofas, ihre Badezimmer. Was immer gerade gebraucht wurde. Yalin sagt, in diesem Moment war ihm klar, dass die Bewegung gewinnen wird. Denn wie soll ein bisschen Gas oder die vermeintlichen 50 Prozent gegen all diese Menschen gewinnen, die auf diese Weise ihre Solidarität ausdrücken?
Gestern Abend ging ein Mann von etwa 65-70 Jahren durch die Gaswolke und verteilte Wasser an alle. Die Verkäufer im Bakkal (Späti), Taxifahrer, StudentInnen, AnwältInnen… Alle sind auf einmal füreinander da. Es scheint keine Unterschiede mehr zu geben. Und das hier, in Istanbul, wo die sozialen Unterschiede eigentlich sehr deutlich waren. Wo die reicheren, den «kleinen» VerkäuferInnen nicht mal richtig in die Augen geschaut haben.
Heute sahen wir sogar zwei Jungs nebeneinander hergehen. Einer im Besiktas-Trikot, der andere im Fenerbahce-Trikot. Das mag euch jetzt nicht so wichtig vorkommen… Aber zwei Fans der beiden sonst bis aufs Blut verfeindeten Rivalen, in ihren Clubfarben, nebeneinander, friedlich im Gespräch … ein zuvor undenkbares Bild! Heute sprachen wir mit einer Mutter und ihrer Tochter. Die Tochter kam gerade aus Ankara zurück. Sie erzählte, sie habe gestern Abend gesehen, dass eine junger Mann am Arm verletzt worden war und blutete. Eine Frau mit Kopftuch sagte: «Was machen sie nur mit uns?», nahm ihr Kopftuch ab (!) und gab es ihm, um seinen Arm zu verbinden. Was auch unglaublich überwältigend ist, sind die «Topf-mit-Löffel-Konzerte» jeden Abend um 9.00 Uhr. Es begann vor ein paar Tagen, dass Leute von zuhause aus ihre Solidarität zeigen wollten. Sie standen an ihren Fenstern und schlugen mit Löffeln auf Töpfe, Siebe, Kannen, was immer Lärm macht. Nun wurde dazu aufgerufen, jeden Abend um 21 Uhr das gleiche zu tun. Vorgestern klopften Freundinnen von mir wie wild, gemeinsam mit einigen Nachbarn, mit denen man sonst nie viele Worte wechselt. Sie riefen sich danach zu:“Yarin ayni zaman görüsürüz!“ Morgen um die gleiche Zeit sehen wir uns wieder! Und heute, ich bin gerade wieder zuhause, weil ich morgen eine Klausur schreiben muss, stand ich mit meiner Schwiegermutter auf dem Balkon und wir klopften wie wild. Aber nicht nur wir. Die gesamte Nachbarschaft. An fast jedem Fenster stehen Menschen mit ihrer Kücheneinrichtung! Dazu schalten die Menschen ihre Lichter immer an und aus. Es sieht wundervoll aus und klingt phantastisch! Autofahrer, die nun mal eben gerade keine Töpfe zur Hand haben, hupen, Fußgänger pfeifen. Gänsehaut, 15 Minuten lang! Und es wurde bisher jeden Abend lauter.
Was auch sehr schön ist, sind die Sprüche, die auf Schildern stehen, an Wände gesprayt werden oder gepostet. Ein Schild sagte: «Thanks Tayyip, for making me feel at home! A Syrien refugee.»
An einer Wand stand: „Liebe Polizei, warum habt ihr uns zum Weinen gebracht? Wir waren auch vorher schon emotional genug.“ Oder (Das Tränengas heisst auf Türkisch Biber Gazi) «Just in Biber»
Was auch wunderbar war, wurde auf Twitter gepostet. Erdogan behauptet ja ständig, dass es lediglich eine Randgruppe ist, die auf der Strasse demonstriert. Und jemand hat gepostet: «Ich laufe mit einer Gasmaske durch die Strasse und trage eine Schwimmbrille. Oh mein Gott, ich bin eine Randgruppe!»
Nun ja, all diese schönen Momente und diese grenzübergreifende Solidarität sind es, die alle immer wieder auf die Strasse bringen. Es sind wieder Tausende im Park und auf dem Platz. Leider wurde in der Nähe wieder Gas geworfen und die Auswirkungen sind bis dorthin zu spüren. Zum ersten Mal seit zwei Nächten muss man nun auch im Park wieder Masken und Schwimmbrillen tragen, nicht nur in Besiktas, wo es übrigens auch gerade jetzt wieder kracht. Ich weiss auch nicht warum ich wieder mal gerade nicht dort bin, sondern zuhause, anstatt im Park wie gestern die halbe Nacht… Vielleicht ist es doch das Nazar Boncugu, das Yalin mir schenkte bevor ich nach Palästina gereist bin, das mich immer wieder vor den gefährlichsten Situationen bewahrt…

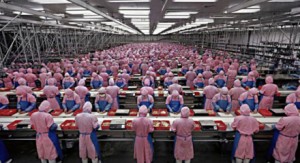




 «Ich bin die neue Bürgermeisterin von Lampedusa. Ich wurde im Mai 2012 gewählt, und bis zum 3. November wurden mir bereits 21 Leichen von Menschen übergeben, die ertrunken sind…, weil sie versuchten, Lampedusa zu erreichen.
«Ich bin die neue Bürgermeisterin von Lampedusa. Ich wurde im Mai 2012 gewählt, und bis zum 3. November wurden mir bereits 21 Leichen von Menschen übergeben, die ertrunken sind…, weil sie versuchten, Lampedusa zu erreichen. Friedensnobelpreis für die Europäische Union? Schlechte Realsatire oder dadaistische Selbstinszenierung, könnte man sich jetzt laut fragen. Oder einfach etwas Balsam auf die krisengeschüttelte Seele der europäischen Zwangsgemeinschaft? Schliesslich hat die EU sonst grad nicht viel zu jubilieren.
Friedensnobelpreis für die Europäische Union? Schlechte Realsatire oder dadaistische Selbstinszenierung, könnte man sich jetzt laut fragen. Oder einfach etwas Balsam auf die krisengeschüttelte Seele der europäischen Zwangsgemeinschaft? Schliesslich hat die EU sonst grad nicht viel zu jubilieren.

 Tamar Gozansky, kommunistische Knesseth-Abgeordnete von 1990 bis 2003, von Beruf Wirtschaftswissenschaftlerin, heute 72 Jahre alt, veröffentlichte im Internet folgenden persönlich gehalten Artikel (leicht gekürzt):
Tamar Gozansky, kommunistische Knesseth-Abgeordnete von 1990 bis 2003, von Beruf Wirtschaftswissenschaftlerin, heute 72 Jahre alt, veröffentlichte im Internet folgenden persönlich gehalten Artikel (leicht gekürzt): Jährliches Ritual bei den Vereinten Nationen: Die UN-Vollversammlung hat von den USA die Aufhebung ihrer Handelsbeschränkungen gegen Kuba gefordert – zum 21. Mal. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Dienstag, 13. November 188 der 193 Mitgliedsländer. Zwei enthielten sich, nur drei Staaten stimmten dagegen: Israel, die kleine Inselrepublik Palau und die USA selbst.
Jährliches Ritual bei den Vereinten Nationen: Die UN-Vollversammlung hat von den USA die Aufhebung ihrer Handelsbeschränkungen gegen Kuba gefordert – zum 21. Mal. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Dienstag, 13. November 188 der 193 Mitgliedsländer. Zwei enthielten sich, nur drei Staaten stimmten dagegen: Israel, die kleine Inselrepublik Palau und die USA selbst. Im 2010 kündigte die liberale Regierung Québecs eine Studiengebührenerhöhung an. Die Studierendenorganisation «CLASSE» (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante) mobilisierte als Antwort darauf zu einem Studierendenstreik. Dieser weitete sich schliesslich zu einer in der Geschichte Kanadas einmaligen sozialen Bewegung aus, die Studierende, SchülerInnen und Lohnabhängige zusammenbrachte. Ein Gespräch mit Katherine Ruault, Studentin und Mitglied von «CLASSE».
Im 2010 kündigte die liberale Regierung Québecs eine Studiengebührenerhöhung an. Die Studierendenorganisation «CLASSE» (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante) mobilisierte als Antwort darauf zu einem Studierendenstreik. Dieser weitete sich schliesslich zu einer in der Geschichte Kanadas einmaligen sozialen Bewegung aus, die Studierende, SchülerInnen und Lohnabhängige zusammenbrachte. Ein Gespräch mit Katherine Ruault, Studentin und Mitglied von «CLASSE».  Der Aufruft der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zum europäischen Protesttag vom 14. November.
Der Aufruft der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zum europäischen Protesttag vom 14. November. Man kann es durchaus als symptomatisch ansehen und es hätte genau so gut in jedem anderen EU-Staat geschehen können: ein griechischer Journalist wurde kürzlich festgenommen und angeklagt, nicht weil er die Unwahrheit verbreitet hatte, sondern weil er ein Stück von der Wahrheit ans Licht brachte. Er veröffentlichte eine Liste von über 2000 reichen Griechen, die ihr Geld auf einer Schweizer Bank vor dem Zugriff der Finanzämter in Sicherheit gebracht hatten. Der Journalist heisst Kostas Vaxevanis und ist Herausgeber und Chefredakteur des Magazins «Hot Doc». Am 28. Oktober hatte ihn ein stattliches Aufgebot von rund einem Dutzend Polizisten aufgrund eines Haftbefehls der Athener Staatsanwaltschaft festgenommen, am 1. November fand auf deren Betreiben ein Prozess gegen ihn statt. Die Anklageschrift beschuldigte ihn der Verletzung des Datenschutzes, weil er vertrauliche private Daten bekannt gemacht hat, sowie der Verleumdung der genannten Personen.
Man kann es durchaus als symptomatisch ansehen und es hätte genau so gut in jedem anderen EU-Staat geschehen können: ein griechischer Journalist wurde kürzlich festgenommen und angeklagt, nicht weil er die Unwahrheit verbreitet hatte, sondern weil er ein Stück von der Wahrheit ans Licht brachte. Er veröffentlichte eine Liste von über 2000 reichen Griechen, die ihr Geld auf einer Schweizer Bank vor dem Zugriff der Finanzämter in Sicherheit gebracht hatten. Der Journalist heisst Kostas Vaxevanis und ist Herausgeber und Chefredakteur des Magazins «Hot Doc». Am 28. Oktober hatte ihn ein stattliches Aufgebot von rund einem Dutzend Polizisten aufgrund eines Haftbefehls der Athener Staatsanwaltschaft festgenommen, am 1. November fand auf deren Betreiben ein Prozess gegen ihn statt. Die Anklageschrift beschuldigte ihn der Verletzung des Datenschutzes, weil er vertrauliche private Daten bekannt gemacht hat, sowie der Verleumdung der genannten Personen. Der Europäische Gewerkschaftsbund erklärt den 14. November zum europäischen Aktionstag «Für Arbeitsplätze und Solidarität in Europa und gegen die Austeritätspolitik» und ruft seine Mitgliedsgewerkschaften mit 60 Millionen Mitgliedern in der Europäischen Union auf zu protestieren, zu demonstrieren und zu streiken. Erstmals wird es in mehreren Ländern gleichzeitig zum Generalstreik kommen. In Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern werden an dem Tag wohl alle Räder still stehen. In Italien sind verschiedene Aktionen geplant. In Italien ruft der kämpferische Gewerkschaftsbund CGIL zu einem vier Stündigen Generalstreik. Basisgewerkschaften sowie kommunistische Parteien und Gruppen haben sich dem Anruf angeschlossen. Die beiden anderen rosaroten Gewerkschaftsbünde UIL und CISL unterstützen den Generalstreik nicht.
Der Europäische Gewerkschaftsbund erklärt den 14. November zum europäischen Aktionstag «Für Arbeitsplätze und Solidarität in Europa und gegen die Austeritätspolitik» und ruft seine Mitgliedsgewerkschaften mit 60 Millionen Mitgliedern in der Europäischen Union auf zu protestieren, zu demonstrieren und zu streiken. Erstmals wird es in mehreren Ländern gleichzeitig zum Generalstreik kommen. In Portugal, Spanien, Griechenland und Zypern werden an dem Tag wohl alle Räder still stehen. In Italien sind verschiedene Aktionen geplant. In Italien ruft der kämpferische Gewerkschaftsbund CGIL zu einem vier Stündigen Generalstreik. Basisgewerkschaften sowie kommunistische Parteien und Gruppen haben sich dem Anruf angeschlossen. Die beiden anderen rosaroten Gewerkschaftsbünde UIL und CISL unterstützen den Generalstreik nicht. Am Montag (Ortszeit) verbreitete der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) ein aktualisiertes Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Sonntag, das sich auf einen Auszählungsstand von 97,65 Prozent bezog. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei für das Land historischen 80,72 Prozent. In 22 der 24 Bundesstaaten Venezuelas konnte sich Chávez durchsetzen, nur Mérida und Táchira an der Grenze zu Kolumbien fielen an die Opposition. Auch im von Henrique Capriles Radonski als Gouverneur regierten Miranda setzte sich Chávez – wenn auch knapp – durch. Am Mittwoch soll Hugo Chávez vom CNE offiziell zum Wahlsieger proklamiert werden.
Am Montag (Ortszeit) verbreitete der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) ein aktualisiertes Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Sonntag, das sich auf einen Auszählungsstand von 97,65 Prozent bezog. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei für das Land historischen 80,72 Prozent. In 22 der 24 Bundesstaaten Venezuelas konnte sich Chávez durchsetzen, nur Mérida und Táchira an der Grenze zu Kolumbien fielen an die Opposition. Auch im von Henrique Capriles Radonski als Gouverneur regierten Miranda setzte sich Chávez – wenn auch knapp – durch. Am Mittwoch soll Hugo Chávez vom CNE offiziell zum Wahlsieger proklamiert werden. Der grösste Platin-Produzent der Welt, Anglo American Platinum, hat einem Bericht des südafrikanischen Nachrichtensenders E-News zufolge am 5. Oktober 12‘000 (!) streikende Kumpels entlassen. Dies berichtete der südafrikanische Nachrichtensender E-News. Die Kumpel hatten wochenlang ihre Arbeitsaufnahme verweigert und sind trotz Erpressungen und Drohungen des Konzerns nicht eingefahren. 100‘000 befinden sich weiter im Streik.
Der grösste Platin-Produzent der Welt, Anglo American Platinum, hat einem Bericht des südafrikanischen Nachrichtensenders E-News zufolge am 5. Oktober 12‘000 (!) streikende Kumpels entlassen. Dies berichtete der südafrikanische Nachrichtensender E-News. Die Kumpel hatten wochenlang ihre Arbeitsaufnahme verweigert und sind trotz Erpressungen und Drohungen des Konzerns nicht eingefahren. 100‘000 befinden sich weiter im Streik. Der „Jan Satyagraha „ Marsch für Gerechtigkeit ist heute in Gwalior gestartet. Mehr als 50’000 Menschen haben sich auf den 350 Kilometer langen Weg nach Delhi gemacht um in der Hauptstadt bei der Regierung ihre Rechte einzufordern. Am 2. Oktober fand der Auftakt statt.
Der „Jan Satyagraha „ Marsch für Gerechtigkeit ist heute in Gwalior gestartet. Mehr als 50’000 Menschen haben sich auf den 350 Kilometer langen Weg nach Delhi gemacht um in der Hauptstadt bei der Regierung ihre Rechte einzufordern. Am 2. Oktober fand der Auftakt statt.