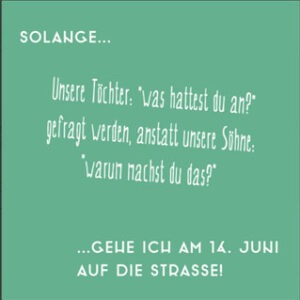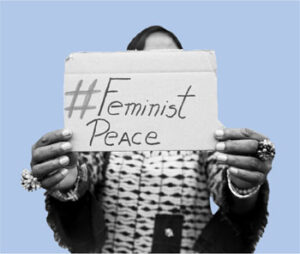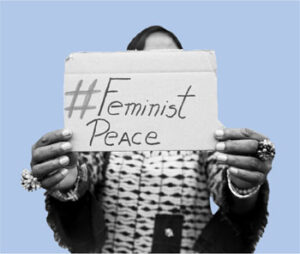 Redaktion. Annemarie Sancar ist promovierte Sozialanthropologin, Aktivistin und Expertin für feministische Friedenspolitik. Bis vor Kurzem arbeitete sie bei der NGO PeaceWomen Across the Globe» und sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen internationalen Netzwerken. Ein Gespräch mit ihr.
Redaktion. Annemarie Sancar ist promovierte Sozialanthropologin, Aktivistin und Expertin für feministische Friedenspolitik. Bis vor Kurzem arbeitete sie bei der NGO PeaceWomen Across the Globe» und sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen internationalen Netzwerken. Ein Gespräch mit ihr.
Annemarie, weshalb ist es wichtig, dass Friedensarbeit feministisch und intersektional ist?
Es ist deshalb wichtig, weil wir aus feministischer Perspektive die Bedingungen, unter welchen Friedensarbeit stattfinden kann – die (toxische) Maskulinität, patriarchale Machtverhältnisse, Geschlechterhierarchien – in den Blick nehmen, auch aus ökonomischer Perspektive. Wenn wir das nicht tun, kommen wir den Ursachen von Konflikt und Krieg nie auf die Spur.
Die NGO «PeaceWomen Across the Globe» betont, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern dass auch patriarchale Strukturen, Machtverhältnisse und Gewalt gegen Frauen entscheidende Faktoren sind. Weshalb ist das zentral?
Patriarchale Strukturen leisten einer Männlichkeit Vorschub, die unter angespannten Bedingungen in kriegerische Maskulinität übergeht und diese nährt sich unter anderem von Gewalt gegen Frauen und sexualisierter Gewalt im Allgemeinen. Die Vergewaltigung der schwächeren Mitglieder des Feindes war und ist bis heute ein immanenter Bestandteil der Kriegsführung. So nimmt während und vor allem auch nach den sogenannten Friedensgesprächen die häusliche Gewalt in der Regel massiv zu.
Wie sieht feministische Friedensarbeit in der Praxis aus? Was gibt es für verschiedene Herangehensweisen und Methoden?
Wir arbeiten für den Frieden, indem wir unter anderem Daten zur Militarisierung und zur Maximierung der Gewinne im Bereich der Kriegsindustrie und High-Tech-Branchen herausarbeiten, um zu zeigen, wie die Care-Infrastruktur darunter leidet. Es geht also um die politische Darlegung der diskriminierenden Ausgabenpolitik, die letztendlich Frauen härter trifft, weil sie immer noch diejenigen sind, die den Grossteil an unbezahlter Care-Arbeit leisten – in Konflikten und Kriegen nimmt dieser Anteil zu. Mit der Verschiebung der öffentlichen Gelder in die profitablen Bereiche, wie die der Waffenindustrie, kommt es zu einem massiven Abbau in der sozialen Infrastruktur: Die Bedingungen, unter welchen Care-Arbeit geleistet werden muss, verschlechtern sich und schwächen diejenigen, die sie verrichten, wie auch diejenigen, die davon abhängig sind. Eine wichtige Methode, um diese Entwicklung zu untermauern, sind von uns organisierte Erzähl-Cafés, in denen Frauen über ihre Sicherheit reden, die sie in erster Linie auf den Alltag beziehen.
Was bedeutet Care-Arbeit im Kontext der Friedensarbeit? Weshalb ist Care-Arbeit zentral im Kampf gegen Krieg und Unterdrückung?
Care-Arbeit belastet Frauen in Kriegssituationen mehr, zum Beispiel in der Pflege von Verletzten und der Sorge um die bleibenden Alten. Zudem ist sie erheblich erschwert, weil kaum Ressourcen zur Verfügung stehen. An die Care-Arbeit denkt niemand. Stattdessen wird investiert in Kampfgeräte, Kampfausrüstung, Kommunikation etc. Es wird wohl – einmal mehr – davon ausgegangen, dass Frauen diese Arbeit ohnehin leisten. Es heisst dann, sie tun dies aus einem Pflichtgefühl dem Land gegenüber, und leider beeinflusst dieses Narrativ die Care-Arbeiter:innen sehr, was ihr Friedenspotential oft unter den Teppich zu wischen droht. Eine verzwickte Situation, die die Stimmen für den Frieden oft zum Verstummen bringt. Hier sind wir wieder bei der feministischen Haltung, nämlich dass Krieg und Konflikte die Militarisierung und damit auch die patriarchalen Machtverhältnisse bedienen. Es braucht in der Friedensarbeit also zwingend eine feministische Perspektive, welche von der Care-Arbeit aus gedacht wird.
Wo siehst du zurzeit die grössten Herausforderungen für die feministische Friedensarbeit?
Für mich ist eines der grössten Probleme ein ökonomisches, indem nämlich der Kriegswirtschaftssektor zu stark wächst und Profit generiert, dieser aber weder in soziale Infrastruktur noch in Umweltschutz und Reinigung der vergifteten Böden investiert wird. Wir müssen deutlich machen, wie enorm die Umweltzerstörung durch die Kriegswirtschaft und Kriegstreiberei zunimmt.
Du selbst verfügst über viele Jahre Erfahrungen in der Arbeit in diesen Kontexten. Was motiviert dich, dich auch weiterhin für diese Themen zu engagieren?
Mich beeindruckt die Friedensarbeit in lokalen Kontexten, die Diskussionen über Sicherheit, die uns immer wieder vor Augen führen, wie die alltägliche Arbeit, vor allem die Care-Arbeit, von grosser Relevanz ist. Dass Waffen ihnen Alltagssicherheit bringen soll, glauben die Frauen in den Krisengebieten kaum. Mich interessiert aber auch die ökonomische Frage, genauer, wie viel Care-Infrastruktur unter der Aufrüstung leidet, wie gross die Gewinne der Rüstungsindustrie dank eines Kriegs sind. Und schliesslich die politische Frage, wer unter diesen Umständen Frieden will, und welche Stimmen sich am Ende durchsetzen. Es ist also immer auch eine politische Frage, und gerade beim Thema Friedenspolitik sind Stimmen feministischer Aktivist:innen zwar laut, aber nicht unbedingt wirkungsvoll. Und das sollte sich endlich mal ändern!
Quelle: feministischerstreikzuerich.ch
 sah. Man kann nicht genug auf die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen: Der Internationale Kindertag am 1.Juni wird in vielen Ländern gefeiert, denn Kinder haben Rechte – und das wissen viele von uns, aber immer noch nicht alle.
sah. Man kann nicht genug auf die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen: Der Internationale Kindertag am 1.Juni wird in vielen Ländern gefeiert, denn Kinder haben Rechte – und das wissen viele von uns, aber immer noch nicht alle.