Was tun mit der UBS?
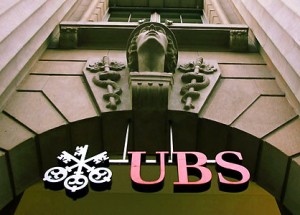 dom. Die Front zwischen UBS und Bundesrat verhärtet sich. Nach dem Untergang der Credit Suisse pocht Bern auf härtere Eigenkapitalvorschriften, die Grossbank droht mit dem Wegzug in die USA. Hinter den Drohungen und der Sicherheitsrhetorik geht es allerdings weniger um Sicherheit, als um Macht und Profit.
dom. Die Front zwischen UBS und Bundesrat verhärtet sich. Nach dem Untergang der Credit Suisse pocht Bern auf härtere Eigenkapitalvorschriften, die Grossbank droht mit dem Wegzug in die USA. Hinter den Drohungen und der Sicherheitsrhetorik geht es allerdings weniger um Sicherheit, als um Macht und Profit.
Der Machtkampf zwischen UBS und Regierung geht weiter. Mitte September wurde bekannt, dass sich die Chefs der letzten Schweizer Grossbank mit der US-Administration getroffen hatten – anscheinend, um nach Wegen zu suchen, die hierzulande drohenden Regulierungen zu umgehen. Ein «Strategiewechsel» werde vorbereitet (New York Post), von «drastischen Schritten» der UBS (Handelszeitung) war die Rede – gemeint war der Umzug in die USA, gar von einer Übernahme oder Fusionen mit einer US-Bank war die Rede.
Unsicherer Finanzplatz
Daraufhin meinte UBS-Chef Sergio Ermotti zwar, ein Wegzug aus der Schweiz stehe nicht zur Debatte – doch die Lage bleibt angespannt. Lars Förberg, Mitgründer des Aktionärs und Investors Cevian (mit rund 1,4 Prozent an der UBS beteiligt), meinte nach dem Treffen zwischen UBS und US-Behörden gegenüber der Financial Times, der Verwaltungsrat habe «die Verantwortung sicherzustellen, dass die UBS ihre Wettbewerbsfähigkeit schützt». Es sei «unter den aktuellen Vorschlägen» nicht machbar, «eine grosse internationale Bank von der Schweiz aus zu betreiben». Cevian sehe «daher keine andere realistische Option als einen Wegzug».
Der Schweizer Finanzplatz besteht im Wesentlichen aus der UBS, seit dem Zusammenbruch der Credit Suisse sehen sich die Finanzbehörden mit wachsendem Zweifel an der Wirksamkeit ihrer Regulierungen und Vorgaben konfrontiert – jetzt will man Stärke demonstrieren. Bereits im April dieses Jahres hatte Finanzministerin Keller-Sutter vorgeschlagen, dass die UBS künftig ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit 100 Prozent (bisher 60 Prozent) Eigenkapital unterlegen solle. Laut Financial Times würde dadurch die Kernkapitalquote von 14 Prozent auf 19 Prozent ansteigen, was den Bedarf um 15 bis 25 Milliarden Dollar erhöhen würde.
Die UBS reagierte mit der «grössten Lobbying-Aktion, die die Schweiz je erlebt hat», kommentierte damals die NZZ: «Mit allen Mitteln» versuche die UBS regulatorische Reformen zu verhindern, ihr Ton werde «schriller», «Halbwahrheiten, Druckversuche und Unterstellungen» würden die Debatte prägen. Ermotti hatte in einem offenen Brief Keller-Sutter als «grösstes Hindernis» für eine erfolgreiche UBS bezeichnet, währenddessen wurden hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Politik, Medien und Behörden würden aktiv bearbeitet, berichtete die NZZ.
KKS bleibt hart
Trotz der Lobbying-Offensive beharrt der Bundesrat auf seinem Kurs. Seit vergangenem Juni liegen die Eckwerte für Gesetzes- und Verordnungsänderungen auf dem Tisch. Gefordert werden – auch für die Tochtergesellschaften – härtere Eigenkapitalvorschriften, klare Verantwortlichkeiten innerhalb der Finanzinstitute, mehr Macht für die Finanzmarktaufsicht, sowie Leitlinien für die Liquiditätsversorgung im Ernstfall. Am meisten gab die Eigenkapitalvorschrift von 24 bis 26 Milliarden Dollar zu reden.
Die UBS warnte vor einem Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit – wahrscheinlich mit der vergleichsweise schwachen Börsen-Performance im Hinterkopf. Ihr Kurs ist in den letzten zwölf Monaten zwar gestiegen – aber weniger stark als jener der meisten anderen europäischen Banken. Bereits im April stand die Drohung eines Wegzugs im Raum. Keller-Sutter blieb gelassen, betonte die Wichtigkeit der UBS für die Schweiz, meinte aber, es sei «nicht Sache des Bundesrates, zu entscheiden, wo die UBS ihren Hauptsitz hat».
Im Gespräch mit dem Blick sagt Ex-Bankenaufseher Daniel Zuberbühler: Ein Wegzug der UBS wäre «nicht erfreulich, aber auch keine Katastrophe». Das Privatkundengeschäft und die Vermögensverwaltung – und damit das profitable Schweizer Geschäft – würden hierbleiben, es drohe auch keine Kreditverknappung. Zu verlieren hätte die Schweiz vor allem «mehrere Tausend Stellen in der Konzernzentrale». Eine Banken-Krise treffe immer «zuerst die hiesigen Mitarbeitenden» und die Gläubiger:innen. Weiter wäre es auch im Sinne der Steuerzahlenden, wenn die Schweiz nicht mehr für die UBS hafte.
Scheindebatte
Damit sagt Zuberbühler Worten dasselbe wie der Bundesrat. In ihrer Mitteilung im Juni meinte die Regierung, die strengeren Vorgaben sollten «die Risiken für den Staat, für Steuerzahlende und die Volkswirtschaft verringern». Aber welchen Schutz bieten strengere Regulierungen wirklich? Über dem Gerede von Eigenkapital, Abwicklungen, Tochtergesellschaften und Liquiditätsvorschriften geht gerne vergessen, dass sich Bankenkrisen nicht wegregulieren lassen.
Die Debatte zwischen UBS und KKS ist eine Scheindebatte: Ein dickeres Polster ist kein Sicherheitsnetz – gerade der Zusammenbruch der Credit Suisse hat das eindrücklich bewiesen. Bis kurz vor ihrem Kollaps war die Bank relativ gut kapitalisiert, doch der teufelskreisartige Vertrauensverlust brachte die Credit Suisse dennoch zu Fall – im Ernstfall zählt nicht die Eigenkapitalquote, sondern das Vertrauen. Wer so tut, als könne man dieses Risiko per Gesetz auflösen, verkauft politische Symbolik als Sicherheitsarchitektur.
Der Streit zwischen KKS und UBS dreht sich also weniger um die Stabilisierung des Schweizer Finanzplatzes als um Macht, geschäftliche Spielräume und Profit. Es geht um die Frage, wie viel politische Rückendeckung die UBS bekommt, wie günstig die Rahmenbedingungen für ihr Geschäft gestaltet werden. Das heisst, es geht letztlich ums Geld – zum Beispiel um Ermottis Jahreslohn von 14,9 Millionen Franken: Gemäss neuster «Lohnschere-Studie» der Unia Platz 4 der bestverdienenden Schweizer:innen.
