 In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen.
In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen.
Beginnen wir mit der vielleicht schwierigsten Frage: Ist «Opération Libertad» nur ein Film über Politik oder ist er auch ein politischer Film?
In einem Film politisch zu sein heisst für mich, eine Verbindung zwischen den Charakteren und der Gesellschaft herzustellen, in der sie leben. Die Story von «Opération Libertad» ist politisch, weil diese Geschichte von Menschen handelt, die die Gesellschaft verändern wollen. Der Film erzählt aber auch von einer Zeit, in der sich politisch mehr bewegt hat.
Ihr Film ist also auch nostalgisch?
Keinesfalls. Mein Film spielt Ende der Siebzigerjahre. Ich war zu dieser Zeit noch ein Kind, die Themen dieser Zeit beschäftigen mich also nicht persönlich. Mein Film sollte daher auch nicht historisch sein. Was mich dagegen schon lange sehr interessiert, ist das politische Engagement. Schon im Alter von dreizehn Jahren las ich Bücher über die «Rote Armee Fraktion». Meinen ersten Film in der Filmschule drehte ich über die Gruppe «Vancouver Five», die in den frühen Achtzigern agierte.
Kann uns diese Geschichte heute noch etwas sagen?
Ich habe diese Zeit gewählt, weil in unseren Gebieten politisch derzeit wenig läuft. Anhand der Geschichte versuche ich zu zeigen, was es heisst, wenn sich jemand dazu entscheidet, die Linie der Legalität aus politischen Gründen zu überschreiten, und welchen Preis diese Person dafür zu bezahlen hat.
Welche Menschen sind es denn, die bereit sind, diese Linie zu überschreiten?
Vor zwanzig Jahren habe ich einen Film über eine Gruppe militanter Aktivisten aus der Schweiz gedreht, die wegen Verbindungen zur Stasi von Carla del Ponte verhaftet wurden. Ich hatte die Chance, mich mit ihnen zu unterhalten, und kam zum Schluss, dass diese militanten Aktivisten vor allem keine aussergewöhnlichen Menschen sind. Ich wollte auch die Protagonisten in meinem Film anders darstellen, wie das etwa in «Der Baader Meinhof Komplex» geschieht.
Wie zeichnet dieser Film seine Figuren?
Der Film ist vor allem ein Actionfilm. Er verhindert aber die Identifikation mit den Figuren. Sie sehen entweder aus wie Superhelden oder wie riesige Psychopaten, sind aber in jedem Fall meilenweit von uns weg.
Der Film ist auch ziemlich ideologisch.
Klar! In diesem Film wird für den Zuschauer oder die Zuschauerin nicht erkennbar, dass diese Aktivist-Innen zur gleichen Welt gehören wie sie oder er. Sie werden behandelt wie Aliens.
Wie stellen Sie die AktivistInnen dar?
Ich versuche sie so darzustellen, wie mir die militanten AktivistInnen begegnet sind, die ich getroffen habe. Diese Leute sind nicht an Waffen, Gewalt oder Action interessiert. Sie sehen Gewalt höchstens als notwendige Folge ihrer politischen Überzeugung. Umso besser aber, wenn sie sie verhindern können. In «Opération Libertad» wollte ich daher von normalen Leuten erzählen, die eine spektakuläre Aktion planen. Die Aktion geht aber schief und sie geraten in eine Situation, die sie komplett überfordert. Plötzlich kippt alles in einen Ernst, den die AktivistInnen nicht beabsichtigt hatten. Die Revolution ist eben kein Spiel.
Für den Film haben Sie eine interessante Erzählform gewählt: Wir sehen vermeintliches Amateur-Filmmaterial, in dem ein Aktivist den Überfall auf
die Bank festhält. Warum?
Ich wollte erreichen, dass der Zuschauer/die Zuschauerin spüren kann, was dieses politische Engagement bedeutet und was schwierig daran ist. Ich zeige auch die Ängste und Zweifel der AktivistInnen und wie sie sich immer wieder selber kritisieren. Um diese Intimität herzustellen, eignet sich ein Familienfilm doch am besten. Ich spiele mit dem Anschein, dass es sich um dokumentarisches Material handelt. So entsteht nicht diese Barriere und das Gefühl, der Inhalt habe nichts mit einem zu tun. Ich mag die Vorstellung, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist, wenn die ZuschauerInnen den Kinosaal verlassen.
Am Schluss des Films spricht der Kameramann zu seiner Tochter, der er das Filmmaterial zeigt, sie könne nun ihre eigene Geschichte daraus gestalten. Was meinen Sie damit?
Es geht mir nicht um die Frage, ob solche Aktionen gut oder schlecht sind. Junge, politisch denkende Leute können sich meinen Film anschauen und vielleicht werden sie davon inspiriert. Es geht mir darum, dass wir weiter über Geschichten wie die von Hugues diskutieren und nicht vergessen, dass solche Dinge möglich sind.
Die Geschichte von «Opération Libertad» erinnert an den Film «Die fetten Jahre sind vorbei». Wurden Sie von diesem Film beeinflusst?
Ich habe mir diesen Film natürlich angesehen und auch einen der Schauspieler, Stipe Erceg, übernommen. Der Film ist gut gemacht, aber ich finde es problematisch, dass er in der Gegenwart spielt. Alles, was der Film zeigen kann, sind symbolische Aktionen: Leute, die in ein Haus einbrechen und Möbel verrücken. Und dennoch werden die AktivistInnen erwischt. Der Film hat aber Recht, wenn er zeigt, dass es heute nicht mehr viele Spielräume gibt. Man wird heute viel schneller erwischt oder gar getötet. Man muss sich bewusst sein: Für militante Aktionen muss man heute bereits sein zu sterben. Die einzigen, die das auf breiter Basis bereit sind zu tun, sind islamistisch Terroristen. Andere politische AktivistInnen weichen daher auf die symbolische, mediale Ebene aus.
Auch die Gruppe in Ihrem Film plant ein solche Medienspektakel, das aber misslingt. Ihre Aktion wird von den Medien totgeschwiegen. Sind Sie diesbezüglich also pessimistisch?
Die Aktion im Film geht ja nicht völlig schief, denn das gestohlene Geld aus der Bank wird danach an GenossInnen im Ausland weitergegeben. Die Aktion ist zur Hälfte erfolgreich und scheitert zur Hälfte. Aber so ist das ja immer mit dem politischen Kampf. Man gewinnt oder verliert nie klar. Für mich ist es wichtig, schon den Willen, bis zum Ende zu gehen, als Erfolg zu sehen. Oder um es einfach zu sagen: Die Bewegung ist wichtiger als ihr Ziel.
Dieser Wille ist heute eine Seltenheit geworden.
Man sieht aber auch überall auf der Welt Leute, die den Atem dazu haben, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es gibt ja auch in Europa und den USA wieder Protestbewegungen. Doch es sieht für mich manchmal so aus, als würden sie gegen eine riesige Wand anrennen. Es scheint heute klar zu sein, dass wir etwas verändern müssen. Wir müssen aber noch nach einem Weg dafür suchen. Mit meinem Film kann ich höchstens zu dieser Suche anregen.
Ihr Film ist aber keineswegs neutral. Sie haben doch offensichtliche Sympathien mit Ihren ProtagonistInnen.
Mein Herz schlägt für eine Seite, das ist klar. Ich bin nicht jemand, der den Kompromiss sucht, ich will aber auch nicht belehrend oder paternalistisch sein. Ich fühle mich auf jeden Fall tief verbunden mit den Aufständischen auf der ganzen Welt.
Aus der vorwärts-Ausgabe vom 26. Oktober 2012













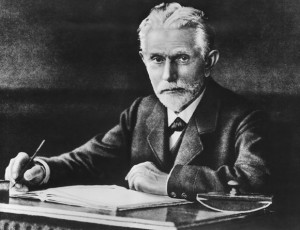

 Der musikszenische Abend zu Hanns Eisler verknüpft Briefmaterial mit Liedern, in dem über die Persönlichkeit Eislers hinaus die Geschichte des 20.Jahrhunderts erfahrbar wird. Ab Mitte Januar im Cabaret Voltaire in Zürich.
Der musikszenische Abend zu Hanns Eisler verknüpft Briefmaterial mit Liedern, in dem über die Persönlichkeit Eislers hinaus die Geschichte des 20.Jahrhunderts erfahrbar wird. Ab Mitte Januar im Cabaret Voltaire in Zürich. Vor dem Film wird jeweils ein kurzer Überblick zum historischen Kontext und den aktuellen Prozessen gegeben, danach steht Zeit für eine Diskussion mit den Filmemachern zur Verfügung. Für Übersetzung ist gesorgt.
Vor dem Film wird jeweils ein kurzer Überblick zum historischen Kontext und den aktuellen Prozessen gegeben, danach steht Zeit für eine Diskussion mit den Filmemachern zur Verfügung. Für Übersetzung ist gesorgt.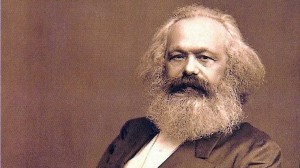 Michael Heinrichs Bücher über die Kritik der politischen Ökonomie geniessen einen guten Ruf – nicht ganz zu unrecht. Und doch muss man sie mit einigem Vorbehalt lesen: Zu schnell begräbt der Autor darin wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Krise und die Klassenfrage.
Michael Heinrichs Bücher über die Kritik der politischen Ökonomie geniessen einen guten Ruf – nicht ganz zu unrecht. Und doch muss man sie mit einigem Vorbehalt lesen: Zu schnell begräbt der Autor darin wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die Krise und die Klassenfrage. In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen.
In «Opération Libertad» erzählt der Filmemacher Nicolas Waldimoff die Geschichte einer militanten linken AktivistInnengruppe aus der Westschweiz, die in eine Bank einbricht, um Verbindungen zur Diktatur in Paraguay nachzuweisen. Der vorwärts hat ihn zum Gespräch über seinen Film getroffen.