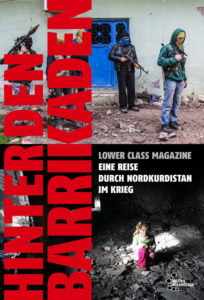Ohne Waffen keinen Krieg
 Die Schweiz exportiere im Jahr 2016 Kriegsmaterial für rund 422 Millionen Franken. Die Waffen werden an Regimes, die Kriege führen und die ihre Bevölkerung unterdrücken, geliefert, solange sie nicht «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind». Jahrelange Kriege wie in Afghanistan, Syrien, dem Irak, im Jemen, im Sudan, in Somalia und anderswo wären nicht möglich, wenn nicht alle Seiten auf direkten oder verschlungenen Wegen von den Industriestaaten mit Rüstungsgütern versorgt würden, auch von der «neutralen» Schweiz.
Die Schweiz exportiere im Jahr 2016 Kriegsmaterial für rund 422 Millionen Franken. Die Waffen werden an Regimes, die Kriege führen und die ihre Bevölkerung unterdrücken, geliefert, solange sie nicht «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind». Jahrelange Kriege wie in Afghanistan, Syrien, dem Irak, im Jemen, im Sudan, in Somalia und anderswo wären nicht möglich, wenn nicht alle Seiten auf direkten oder verschlungenen Wegen von den Industriestaaten mit Rüstungsgütern versorgt würden, auch von der «neutralen» Schweiz.
Laut der offiziellen Statistik des Bundes exportierte die Schweiz von 1975 bis 2016 für 17,5 Milliarden Franken Kriegsmaterial. Verkauft wurden diese Rüstungsgüter zu einem grossen Teil an kriegführende Staaten, in Spannungsgebiete, an menschenrechtsverletzende Regimes und an arme Länder in der Dritten Welt. In den 17,5 Milliarden Franken sind die besonderen militärischen Güter nicht eingerechnet, die ebenfalls exportiert wurden, aber nicht in der offiziellen Statistik erscheinen. Auch die Finanzierung von Waffengeschäften durch Schweizer Banken erscheinen in diesen Zahlen nicht. Schweizer Geldinstitute, die Nationalbank, Banken und Pensionskassen investierten in den letzten Jahren auch in Firmen, die an der Atomwaffenproduktion, an der Herstellung von Antipersonenminen und Clusterbomben beteiligt sind.
Strafrechtliche Verantwortung
Für Kriegsmateriallieferungen ist das Strafrecht nicht einfach ausser Kraft gesetzt. Es gibt keinen strafrechtlichen Freipass für FabrikantInnen und PolitikerInnen, die Rüstungsgüter liefern an Regimes, die Kriege führen und die ihre Bevölkerung unterdrücken. Unter Artikel 25 des Schweizerischen Strafgesetzbuches fallen nämlich Delikte wie Beihilfe zum Mord, zu vorsätzlicher Tötung, zu schwerer Köperverletzung und zu schwerer Sachbeschädigung. Gehilfe bei solchen Straftaten ist derjenige, welcher «zu einem Verbrechen oder zu einem Vergehen vorsätzliche Hilfe leistet», wer also auch «vorsätzlich in untergeordneter Stellung die Vorsatztat eines andern fördert».
70 ExpertInnen in Völkerrecht und Strafrecht kritisierten schon vor acht Jahren die Nichteinhaltung der Kriegsmaterialverordnung, im Oktober 2009 in einem offenen Brief an den Bundesrat. Ihre Aussage: Das Exportverbot für Kriegsmaterial gilt für Länder, die «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind». Simon Plüss vom Seco erklärte daraufhin, der Bundesrat habe das Exportverbot immer dahingehend ausgelegt, dass es sich auf einen internen Konflikt im eigenen Land bezieht. Im Falle eines Bürgerkriegs in Saudi-Arabien oder in den USA gäbe es keine Rüstungsausfuhren in diese Länder mehr.
Deutschland beteiligt sich am Krieg
2016 wurde für rund 422 Millionen Franken Kriegsmaterial exportiert. Deutschland war dabei der grösste Abnehmer von Kriegsmaterial. Für 93,2 Millionen Franken bezog Deutschland aus der Schweiz, Bestandteile zu gepanzerten Radfahrzeugen, Munition (der Ruag), Komponenten zur Fliegerabwehr (von Rheinmetall) und Klein- und Leichtwaffen.
Nach den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris, kündigte die deutsche Bundesregierung an, sich mit einem Bundeswehreinsatz in Syrien zu beteiligen. Am 4. Dezember 2015 beschloss auch der Deutsche Bundestag die Beteiligung Deutschlands am Kampf gegen den Daesh. Wie es hiess, ist zunächst vorgesehen die Bundeswehr mit bis zu 1200 SoldatInnen ausserhalb Syriens zur Unterstützung einzusetzen.
Die deutsche Tochter der bundeseigenen Ruag der Schweiz lieferte 2014 vier Millionen Schuss Munition den kurdischen Peschmerga-KämpferInnen im Irak, die noch heute in den Krieg verwickelt sind. Was meinte Bern zu diesem Geschäft? «Die Ausfuhr von in Deutschland produzierter Munition der Ruag in den Irak unterliege der Exportkontrolle der deutschen Behörden. Eine Zuständigkeit der Schweiz sei nicht gegeben», erklärt eine Sprecherin des zuständigen Staatssekretariats für Wirtschaft in Bern.
Initiative der Gsoa
Die Ruag gilt als grösste Munitionsherstellerin in Europa. 2013 erzielte die Munitionssparte Ruag Ammotec einen Umsatz von 354 Millionen Franken. Mit Gewehrkugeln, mit Munition für Kleinwaffen, kommen in Konflikten weltweit mehr Menschen um als bei Bombardierungen und Kämpfen mit schweren Waffen.
Eva Krattiger, Sekretärin der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa), erinnerte an der Pressekonferenz in Bern an die Rolle des Finanzplatzes Schweiz: «Über die Schweiz fliessen jährlich mindestens 15 Milliarden Franken in die Rüstungsindustrie.» Die Gsoa wird deshalb zusammen mit anderen Organisationen im Frühling eine Volksinitiative lancieren, welche die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten verbieten will.
Aus dem vorwärts vom 7. April 2017 Unterstütze uns mit einem Abo.