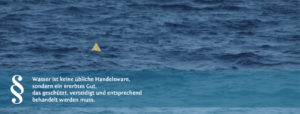Sparen auf Kosten der Ärmsten
 dab. Weitere dreiste Machtdemonstrationen in den Eidgenössischen Parlamenten: Die Mehrheitsvertre-tung des Kapitals gefällt sich im rücksichtslosen, repressiven Sparwahn bei Ergänzungsleistungen und Krankenkassenfranchisen. Widerstand ist angesagt.
dab. Weitere dreiste Machtdemonstrationen in den Eidgenössischen Parlamenten: Die Mehrheitsvertre-tung des Kapitals gefällt sich im rücksichtslosen, repressiven Sparwahn bei Ergänzungsleistungen und Krankenkassenfranchisen. Widerstand ist angesagt.
Nicht nur bei der neusten IV-Revision wird gekürzt und geknausert (siehe Artikel Titelseite). In den eidgenössischen Räten wurde soeben die Erhöhung der Krankenkassen-Franchisen beschlossen. Der Sparhammer wird auch bei den Ergänzungsleistungen (EL) angesetzt. Über 300000 betagte und behinderte Menschen sind in der Schweiz auf Ergänzungsleistungen angewiesen. In letzter Zeit wurden die EL in vielen Kantonen bereitsgesenkt. Aber genug ist für die Reichen und Mächtigen nicht genug: Bald werden die Bedürftigen mit noch weniger Geld auskommen müssen. Das heisst konkret: Parlamentarier*innen vor allem der Parteien SVP und FDP, die in der Regel im Rat und privat sehr gut verdienen und in den Genuss von Steuergeschenken kommen, spielen sich machtvoll als Sparenthusiasten auf Kosten der Ärmsten auf. Im Nationalrat stimmten sie mit ihrer absoluten Mehrheit geschlossen für die drastischen Reduktionen aus. Der definitive Entscheid bezüglich EL fällt Ende März, das Referendum ist bereits angekündigt.
Franchisen sollen steigen
Bereits beschlossen wurde im Nationalrat die Erhöhung de Franchisen-Minimums von 300 auf 350 Franken. Die stetige und unbegrenzte Steigerung der Franchisen parallel zur Kostenentwicklung im Gesundheitswesen wurde im letzten Moment fallengelassen, wahrscheinlich mit Blick auf das Referendum. Die Tendenz zur steigenden Belastung der Versicherten geht dadurch weiter, aber nicht so schnell wie es die kommerzielle Lobby zugunsten der schnelleren Steigerungen der Renditen und Reserven der Krankheitsindustrie gerne gehabt hätte. Bereits heute müssen die Patient*innen in der Schweiz mehr an die Behandlung bezahlen als sonst wo in Europa. Die Folge: Immer mehr Menschen lassen sich nicht ärztlich behandeln, weil sie die Kosten nicht tragen können. Das führt zu einer unsozialen Zweiklassenmedizin sowie im Endeffekt zu mehr Kosten, wenn notwendige Behandlungen hinausgeschoben werden. Selber schuld, sagen die Neoliberalen und zucken die Schultern, wer hart arbeite und innovative Ideen vermarkte, sei zahlungsfähig. Und hohe Franchisen würden die Versicherten davon abhalten, wegen jedem Hüsteln und Unwohlsein zum Arzt zu rennen. Die breite Allianz «Nein zur Franchisen-Explosion» ergreift gegen die Kostenabwälzung auf die Patient*innen das Referendum.
Heisser Sparwettbewerb
Am 31. Mai 2017 begann der Ständerat an der Revision der Ergänzungsleistungen (EL) in der Fassung der Sozialkommission zu laborieren, darauf ging die Vorlage im vergangenen Jahr mehrmals pingpong zwischen den Räten hin und her und wurde zuletzt am 6. März dieses Jahres vom Nationalrat sparwutmässig aufgemischt. Die grosse Kammer will wesentlich mehr auf dem Buckel der IV- und AHV-Bezüger*Innen sparen als die kleine, deshalb arbeitete die Einigungskonferenz Anfang Monat einen Kompromissantrag aus.
Der von FDP und SVP dominierte Nationalrat will die EL für Behinderte und Betagte laut dem kritischen Schweizer Nachrichten-Portal Conviva-plus.ch dreimal mehr kürzen als der Ständerat: «Konkret bedeuten die Nationalratsbeschlüsse jährliche EL-Einsparungen von 700 bis 770 Millionen Franken brutto.» Die Massnahmen führen laut offizieller Verlautbarung auf parlament.ch aber nur zu Einsparungen «von 453 Mio. Franken gegenüber 427 Mio. gemäss Beschluss des Ständerats respektive 463 Mio. gemäss Beschluss des Nationalrats». Wie gerne sich der Bund bei solchen Berechnungen irrt, zeigte der Betrag der Steuereinbussen im Abstimmungsbüchlein der Unternehmenssteuerreform II: FDP-Finanzminister Hans-Rudolf Merz hatte die Kosten der Reform mit 900 Millionen beziffert. Später stellte sich heraus, dass stattdessen eine Milliarden Franken in der Staatskasse fehlten – was dem Bundesrat eine Rüge des Bundesgerichts einbrachte. Bei der – zum Glück vom Stimmvolk abgelehnten – Unternehmenssteuerreform III gab Finanzminister Ueli Maurer die Steuerausfälle mit 1,1 Milliarden Franken an, obwohl die Eidgenössische Steuerverwaltung die bisher bekannten Kosten mit etwa drei Milliarden Franken beziffert hatte.
Vermögen und Rückzahlung
Der Antrag der Einigungskonferenz beinhaltet laut parlament.ch folgende Hauptpunkte: Alleinstehende Personen mit mehr als 100000 Franken Vermögen oder Ehepaare mit mehr als 200000 Franken Vermögen sollen keine Ergänzungsleistungen beanspruchen können. Nach dem Tod eines/r Bezügers*in sollen die erhaltenen EL aus jenem Teil des Erbes, der 40000 Franken übersteigt, an den Staat zurückerstattet werden. Die Vermögensfreibeträge sollen auf den Stand vor der Neuordnung der Pflegefinanzierung gesenkt werden, dabei soll aber die Teuerung berücksichtigt werden. Der Einigungsantrag wird am 18. März im Ständerat und am 19. März im Nationalrat behandelt. Die Behindertenverbände wie deren Dachverband Inclusion Handicap sowie die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (Sodk) kritisieren die entstehende EL-Sparrevision. Die Rentner*innenorganisation Avivo kündigte bereits das Referendum an.