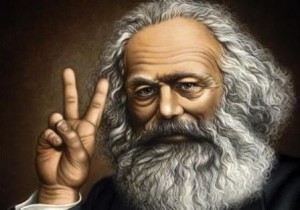Braucht es in Zeiten der Individualisierung, wo scheinbar auch für Frauen* alles/vieles möglich ist – zum Preis von gewissen Anpassungsleistungen – überhaupt noch die Frauen*demo am 8. März als Ausdruck des kollektiven Kampfes gegen das kapitalistische Patriarchat? Es ist uns bewusst, dass wir diese rhetorische Frage nur aus einer privilegierten Position stellen können. Es ist uns aber wichtig, dieser Frage nachzugehen, weil durch die Tendenz, Geschlecht nur noch als konstruierte soziale Kategorie zu sehen, reale Unterdrückungsverhältnisse verwischt werden. So haben wir eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie Frauen* das in unserem näheren und weiteren Umfeld sehen. Ohne näher auf die Genderfrage einzugehen, fragten wir: «Braucht es den 8. März überhaupt noch und warum?»
Braucht es in Zeiten der Individualisierung, wo scheinbar auch für Frauen* alles/vieles möglich ist – zum Preis von gewissen Anpassungsleistungen – überhaupt noch die Frauen*demo am 8. März als Ausdruck des kollektiven Kampfes gegen das kapitalistische Patriarchat? Es ist uns bewusst, dass wir diese rhetorische Frage nur aus einer privilegierten Position stellen können. Es ist uns aber wichtig, dieser Frage nachzugehen, weil durch die Tendenz, Geschlecht nur noch als konstruierte soziale Kategorie zu sehen, reale Unterdrückungsverhältnisse verwischt werden. So haben wir eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie Frauen* das in unserem näheren und weiteren Umfeld sehen. Ohne näher auf die Genderfrage einzugehen, fragten wir: «Braucht es den 8. März überhaupt noch und warum?»
Haben Frauen* alles erreicht?
«Bester Tag im Jahr. So viele Leute, die sich mobilisieren. Ich ziehe viel Energie daraus. Es ist unser Tag, es gibt eine emotionale Bindung. Und es ist eine radikale Demo.»
«Ich bin nicht so politisch und auch wenn ich nicht an die Demo gehe, treffe ich mich mit Frauen zum Austausch an diesem Tag. Es passiert an vielen Orten etwas – auch für diejenige, die kein Demo-Mensch ist, gibt es Möglichkeiten, den Tag zu begehen. Der Tag hat eine starke Ausstrahlung. Die Demo ist sehr wichtig und sie animiert auch zu anderen Aktivitäten.» «Natürlich braucht es den 8. März, da das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen* weiterhin existiert.» «Wo immer ich hinschaue, die Unterdrückung der Frau* ist immer noch real präsent: Kriege überall, sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Ausbeutung in der Familie, am Arbeitsplatz, Lohngefälle, Sexarbeit, Reproduktionsarbeit, Schönheitschirurgie. Die Liste könnte lange werden…» «Der 8. März ist für Frauen* auf der ganzen Welt ein wichtiges Datum. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Es ist noch lange nicht erkämpft, was uns Frauen* zusteht.» «Ja, es braucht den Tag als Frauen – ohne * -kampftag. Als Zeichen gegen Aussen, dass eine Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht ist und als Zeichen gegen Innen, zur Stärkung unserer eigenen Kräfte.»
«Da wir immer noch keine echte Gleichberechtigung, Lohngleichheit und Wahlmöglichkeiten haben, ist die jährliche Erinnerung daran und die kritische Auseinandersetzung damit schon noch aktuell. Ob diese Generation, oder auch jede andere, (ich selbst bin 38 Jahre alt) allerdings die bisherigen Wege, mit Demos und dergleichen, beschreiten sollte, das ist wirklich zu diskutieren. In welcher Form könnte diese Diskussion nachhaltig auch Veränderungen bringen? Was sind die Bedürfnisse über dies hinaus, was beschäftigt junge Frauen wirklich, wo sehen sie sich blockiert?»
Patriarchale Werte im Aufwind
«Ja, es braucht einen internationalen Frauentag, insbesondere in diesen Zeiten, wo das Patriarchat sich so zügellos gebärdet.» «Den 8. März braucht es mehr denn je, denn in Zeiten, in denen Feminismus im Hinblick auf eine angebliche Überlegenheit der eigenen Kultur thematisiert und als Vehikel benutzt wird, einem nationalistischen, rassistischen Chauvinismus Vorschub zu gewähren, muss daran erinnert werden, dass sich der feministische Kampf immer auch gegen die Werte des sogenannten «Abendlandes» richtet. Feminismus ist ein emanzipatorischer Kampf gegen den reaktionären Chauvinismus des «Abendlandes». Am 8. März tragen wir diesen auf die Strasse.»
Der 8. März hat Geschichte
«Es braucht den 8. März, damit wir an all die Frauen* erinnern, die vor uns gekämpft haben und uns den Weg vorbereitet haben.» «Ja, es braucht den 8. März noch! Er symbolisiert eine wichtige Tradition organisierten Frauenwiderstandes gegen patriarchale Herrschaft. Wichtig ist auch die Vielfalt der Manifestationen an kreativen, mutigen, kämpferischen, intelligenten, diskursiven etc. Formen, den 8. März zu begehen. Wir müssen aber aufpassen, dass unsere Slogans und Forderungen nicht bis zum Abwinken zu leeren Floskeln verkommen, sondern ihre Bedeutung behalten. Und vielleicht wären manchmal etwas positivere Slogans – für unsere Visionen statt gegen alles – motivierender.» «Die Tradition der 8. März Demo in Zürich braucht es unbedingt noch! Weil es eine der Gelegenheiten ist, bei denen Frauen* ohne Männer was Grosses auf die Beine stellen. Das macht mega Spass, gibt viel Energie und vor allem ist es ermächtigend. Und auch, weil mir jedes Mal an der Demo auffällt, wie viele Männer sich angegriffen fühlen und sehr aggressiv reagieren alleine durch die Tatsache, dass es Frauen* wagen, sich Raum zu nehmen und laut zu sein, ein Privileg, das sonst nur Männer geniessen. Also, leider noch nichts mit Gleichberechtigung der Geschlechter, darum weiterhin einen kämpferischen 8. März!» «Auch wenn der Diskurs über die Kategorie Geschlecht als wissenschaftspolitische Folge aus der Frauen*bewegung erwachsen ist, heisst das nicht, dass nun Geschlechter in dieser dualistischen Ordnung nur als relationale Kategorie und nicht auch als situative, politische Subjekte begriffen werden müssen. Auch wenn die duale Geschlechterordnung nicht reproduziert wird oder reproduziert sein soll, bleibt sie doch als ein zu kritisierendes und analysierendes Problem bestehen. Darum, auf die Strasse! Lassen wir uns nicht auseinanderdividieren und treffen uns an den restlichen 364 Tagen, um für eine heterogene, freie Welt zu kämpfen!» «Unser Feminismus muss internationalistisch und antikapitalistisch sein, das heisst auch, alle Unterdrückungsverhältnisse müssen benannt und bekämpft werden. Sonst entstehen immer wieder neue Formen der Macht.»
Das F*LK meint dazu: Solange gehen wir auf die Strasse!
Solange die Gewaltkultur gegen Frauen* und Mädchen* nicht gestoppt und aufgearbeitet wird; solange die patriarchale Justiz Frauen*, die sich gegen ihre Peiniger wehren, massiv härter bestraft, als Männer, die Frauen* angreifen; solange durch die Abwertung des «Anderen» und «Fremden» Ausgrenzung und Gewalt gegen Gruppen der Gesellschaft befördert und legitimiert werden, solange gehen wir auf die Strasse. Solange jedermann sich herausnimmt, Frauen* zu bewerten, solange Frauen* sich den auf sie gerichteten patriarchalen Blick zu eigen machen und sich körperlich und seelisch verformen, um dem perfekten Bild zu entsprechen; solange Mann seine Frau, seine Kinder, seine Mutter oder Schwester als sein Eigentum betrachtet, über das er verfügen kann, wie er will; solange Frau* die Mehrheit der gesellschaftlichen Arbeit erledigt und ihr gleichzeitig suggeriert wird, sie sei nichts wert; solange die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen* überall immer wieder ignoriert, geleugnet und unter den Tisch gewischt werden, solange gehen wir auf die Strasse. Nicht zuletzt gehen wir am 8. März auf die Strasse, um an all jene Frauen* zu erinnern, die seit Jahrtausenden einzeln und kollektiv für eine bessere Gesellschaft gekämpft haben und für ihre und unsere Befreiung ein- und weggesperrt, gefoltert, geschlagen, vergewaltigt und ermordet worden sind. Am 8. März wollen wir uns nicht nur auf eine lange Geschichte von Frauen*kämpfen beziehen, sondern unsere Solidarität zu den heute weltweit kämpfenden Frauen* ausdrücken und uns mit ihnen vernetzen. So kämpft die kurdische Frauen*bewegung mit einer eigenen Frauen*armee gegen den IS, gegen Ehrenmorde und gegen Gewalt an Frauen*. Sie baut auf die eigene Stärke sowohl im militärischen wie auch bei der Konstituierung einer neuen Gesellschaftsordnung. Für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen*, für das Recht auf Abtreibung und gegen Frauen*morde gehen weltweit immer mehr Frauen* auf die Strasse, zum Beispiel in Argentinien, Chile, Bolivien und Mexiko. Frauen* der Gulabi Gang in Nordindien setzen sich für Frauen*rechte und gegen soziale Ungerechtigkeiten ein. Sie tragen rosa Saris und rosa Schlagstöcke aus Bambus. «Wenn unsere Selbstachtung mit Füssen getreten wird, setzen wir sie ein». In der Gruppe sind mehrere Tausend Frauen* organisiert!
Feministisch agieren
Die Schwarze Feministin Audre Lorde schrieb 1984: «Unser zukünftiges Überleben gründet sich auf unsere Fähigkeit, gleichberechtigt miteinander umzugehen. Als Frauen müssen wir verinnerlichte Verhaltensmuster der Unterdrückung in uns selbst mit der Wurzel herausreissen, wenn wir über die oberflächlichsten Aspekte sozialer Veränderung hinausgehen wollen. Jetzt müssen wir Unterschiede zwischen Frauen als Unterschiede zwischen Gleichberechtigten sehen, weder als Zeichen der Überlegenheit noch der Unterlegenheit, und Wege ausfindig machen, um unsere jeweiligen Unterschiede dazu zu nutzen, unsere Visionen und gemeinsamen Kämpfe zu bereichern. […] Die alten Verhaltensmuster, egal wie geschickt sie umfrisiert werden, um nach Fortschritt auszusehen, verurteilen uns zu nur kosmetisch veränderten Wiederholungen derselben alten Wortwechsel, derselben alten Schuldgefühle, desselben Hasses, derselben Vorwürfe, Klagen, Verdächtigungen.» Zehn Jahren später kritisierte die «Rote Zora», eine militante feministische Gruppe in Deutschland: «Mit dem Rückzug auf uns und der vorrangigen Beschäftigung, unser Bewusstsein zu sensibilisieren, befinden wir uns voll im herrschenden gesellschaftlichen Trend zur weiteren Individualisierung und Auflösung gemeinsamer sozialer Erfahrungen.»
Trotz den weltweit brutalen Realitäten lassen wir uns nicht erdrücken, sondern wehren uns, indem wir für eine Welt kämpfen, die nicht nach Geld, Leistung und Profit strebt und die sich nicht über patriarchale Gewalt und entlang herrschaftssichernden Grenzen organisiert. Wir wollen eine Gesellschaft, die von allen Menschen – unabhängig ihrer Herkunft und ihres Geschlechts – mitbestimmt wird. Deshalb braucht es eine starke feministische Selbstorganisierung, in der Frauen* eigenständige Denk- und Handlungssysteme aufbauen und ihre eigenen Vorstellungen von Befreiung entwickeln. Und nochmals Audre Lorde zum Schluss: «Ich bin nicht frei solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich.»
Frauen*LesbenKasama, feministischer Treffpunkt für Heteras, Lesben und andere Weiblichkeiten, Militärstrasse 87a, 8004 Zürich – jeden 1. und 3. Dienstag ab 19 Uhr, frauenlesben@kasama.ch
Aus dem vorwärts vom 03. März 2017 Unterstütze uns mit einem Abo.
 Die Schweiz exportiere im Jahr 2016 Kriegsmaterial für rund 422 Millionen Franken. Die Waffen werden an Regimes, die Kriege führen und die ihre Bevölkerung unterdrücken, geliefert, solange sie nicht «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind». Jahrelange Kriege wie in Afghanistan, Syrien, dem Irak, im Jemen, im Sudan, in Somalia und anderswo wären nicht möglich, wenn nicht alle Seiten auf direkten oder verschlungenen Wegen von den Industriestaaten mit Rüstungsgütern versorgt würden, auch von der «neutralen» Schweiz.
Die Schweiz exportiere im Jahr 2016 Kriegsmaterial für rund 422 Millionen Franken. Die Waffen werden an Regimes, die Kriege führen und die ihre Bevölkerung unterdrücken, geliefert, solange sie nicht «in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind». Jahrelange Kriege wie in Afghanistan, Syrien, dem Irak, im Jemen, im Sudan, in Somalia und anderswo wären nicht möglich, wenn nicht alle Seiten auf direkten oder verschlungenen Wegen von den Industriestaaten mit Rüstungsgütern versorgt würden, auch von der «neutralen» Schweiz.